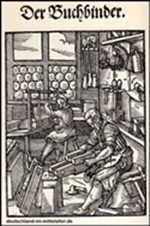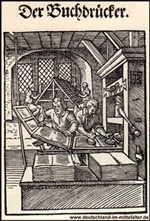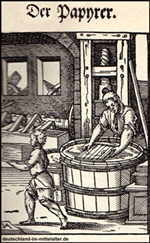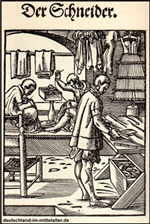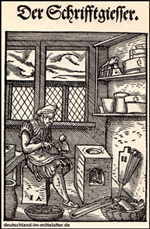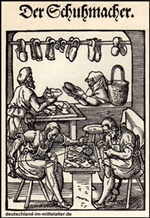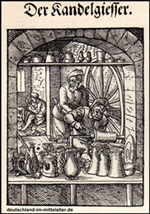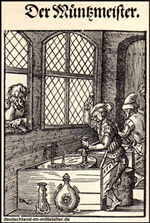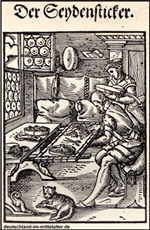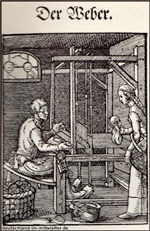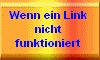- Abdecker. Er
hatte zur Aufgabe Teile der toten Körper von verendeten Tieren
weiterzuverwerten. Der Ausdruck "abdecken" ist ein anderes
Wort für "enthäuten der Tierkadaver".
- Abtrittanbieterin.
Ein Beruf, den es in der ersten hälft des 19. Jahrhunderts
für einige Jahre gegeben hat. Es handelt es sich um eine Art
Klofrau. Allerdings betrieben diese Damen ihr Gewerbe mobil, typischer
Weise in Großstädten. Das Gewerbe wurde eingeführt,
um zu verhindern, dass die Straßen nach Fäkalien stanken.
Sie waren also im Stadtgebiet unterwegs und trugen zwei Eimer bei
sich, in die hinein die Kunden sich erleichtern konnten. Dabei verbargen
sich diese unter einem weiten langen Umhang, den die Abtrittanbieterinnen
zu diesem Zweck um die Schultern trugen. In den Eimern wurden die
Fäkalien fast wie in einer heutigen Kompost-Toilette mit Stroh
oder Laub vermischt, das auch den Zweck des damals noch nicht bekannten
Toilettenpapiers erfüllte. Durch den Bau von Kanalisationen
verschwand der Berufsstand und die öffentliche Toilette hielt
Einzug in die Städte.
- Bader und Barbier.
Sie waren vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert für die Körperpflege
und die wundärztliche Versorgung der Bevölkerung zuständig.
Schon im Hochmittelalter waren die Bader Betreiber öffentlicher
Badestuben. Zum baden gehörte auch das Kopfwaschen, das Kämmen,
das Haareschneiden und das Rasieren („barbieren“). Die
medizinischen Arbeiten des Baders bestanden im Schröpfen oder
Aderlassen, Prophylaxe und Therapie sowie in der Wundversorgung.
Neben den äußerlichen wundärztlichen chirurgischen
Eingriffen behandelten sie auch mit innerlich wirkenden Medikamenten.
- Bartscherer und Barbier.
Er zog auch Zähne, setzte Schröpfköpfe an, fertigte
Masken, Perücken und Bärte.
- Blaufärber.
Die Arbeit des Blaufärbers bestand im Färben des groben
Wolltuches, das die Bauern kauften.
- Bogner und Armbruster
fertigten aus Eibe den Bogen bzw. aus Ahorn die Armbrust. Die Sehne
wurde aus Darmsaite hergestellt. Die Spannvorrichtung vervollständigte
die Armbrust.
- Bürstenbinder und
Pinselmacher. Die Bürsten und Pinsel wurden aus Tierhaaren
gefertigt, anschließend mit einem Draht in ein Brettchen eingezogen.
Im Spaß nannte man die Bürstenbinder auch Fürstenkinder.
- Fackler stellte
"Fackelchen" her, Die Vorläufer der Streichhölzter.
Diese bestanden aus Holzspänchen oder einem Stückchen
Flachs oder Hanf, das in Schwefel getaucht wurde. Ein glimmender
Zunder konnte sie sofort in Brand versetzen.
- Filzmacher
bereitete die "Stumpen", pelzkappenartige Gebilde, für
den Hutmacher vor. Dazu diente eine hölzerne Form, auf die
mit der "Zienenbiss" Wollbüschel "geschossen"
wurden.
- Gas- und Wasserinstallateure
sind jetzt Anlagenmechaniker
für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik.
Die alte Berufsbezeichnung wurde durch die unsinnige Zusammenlegung
mit dem Zentralheizungs- und Lüftungsbauer abgeschafft.
- Gelbgießer
fertigte aus Messing und Bronze Schnallen, Schellen, Ziernägel,
Kleiderhänger.
- Gerber verarbeiten
Häute und Felle für die Weiterverarbeitung in der Sattlerei
und der Schuhindustrie und zur Bekleidungs- und Handschuhherstellung.
- Grauhosenschneider.
Der Kunde musste sich auf den Boden legen, auf dem das Wollzeug
ausgebreitet war. Nun zeichnete der Grauhosenschneider die Beinumrisse
des Kunden mit Kreide auf den Stoff und erhielt so den "Schnitt"
für die Hose. Solche Hosen waren so steif, dass sie von alleine
standen.
- Guverriererin.
Das ist einer der wenigen Frauenberufe, nähte Leibchen, Hemden
und Trachtenkleider mit dichten Säumchen.
- Hutmacher färbte
den rohen Stumpen und zog ihn nass auf eine hölzerne Form,
auf der durch heißes Bügeln der gewünschte Hut entstand.
- Klöpplerin.
Diese heute fast vergessene Technik, die früher von vielen
Frauen beherrscht wurde, diente zu Fertigung von Spitzen.
- Knopfsticker.
Ein aus Holz gedrechselter Knopf wurde mit einem kunstvollen Muster
umstrickt. Diese Knöpfe dienten zum Befestigen des Steppdeckenbezuges.
- Kouftner. Dies
ist der Grundbegriff der Böttcher, Büttner, Fassbinder,
Küfer, Kuftner und Schäffler.
Ihre Aufgabe war die Herstellung von Tonnen und Fässern. Diese
„Container“ für feste und flüssige Waren sind
immer noch für den Warenaustausch notwendig.
- Kraxenträger
tragen die Ware (Heu, Holz, Erze) mit den in den Bergen üblichen
Kraxen.
- Lohmüller
mahlten in der Lohmühle die Eichenrinde, die zum Gerben von
Sohle und Leder gebraucht wurde.
- Mantelschneider
fertigten Kirchenpelze an.
- Messerschmiede
waren meistens Hausierer, welche Messer, große Gabeln, kleine
Spieße, Nägel und Schuheisen herstellten.
- Pfeilschnitzer
heißt in Mundart "Ziehnemacher". Gemeint ist der
hintere Teil des Pfeiles, den man beim Spannen des Bogens anfasst
und der für die Treffsicherheit wichtig ist.
- Rastelbinder
stellten aus Draht Vorrichtungen zum Rösten und Grillen her.
- Samer oder
Säumer transportieren die Güter indem
sie diese auf auf Pferde oder Maultiere binden.
- Scharfrichter
(Henker, Schinder, Züchtiger). Dieser Beruf
wurde als unangenehm und unmoralisch angesehen. In der städtischen
Gesellschaft des Mittelalters waren sowohl er, seine Frau als auch
seine Kinder wegen seinem Beruf verachtet.
- Schieferdecker.
Auf Grund der hohen Brandgefahr wurden die Schindel- und Strohdächer
in den Städten mit Schiefer gedeckt.
- Schindler decken
die Dächer mit Holzschindeln und Stroh.
- Sehnenmacher.
Die Sehne bestand aus Darm, der zu einer gewundenen Schnur verarbeitet
wurde und mit Alaun gegerbt war. Sie diente zum Bespannen des Bogens
von Musikinstrumenten, als Radantrieb und zum Nähen von Wunden.
- Stärrbäcker
hat nur Brot gebacken und sonst keine Backwaren. Den Teig bereiteten
die Hausfrauen zu und trugen ihn zum Bäcker.
- Täschner (Feintäschner)
verwenden weiches Kalb-, Lamm-, Pferde- oder auch Reptilleder und auch die
Nähtechnik unterscheidet sich von der des Sattlers. Der Täschner fertigt feine
Lederwaren wie Taschen, Gürtel, Schutzhüllen, Accessoires u.v.m.
- Tapisseriestickerin
bestickte Wandbehänge, Altardecken, Trachtenkleider, Vordrucke
von Handarbeiten.
- Totengräber
mussten die Leiche vor dem Begräbnis waschen, herrichten und
richtig in das Grab legen, das sie vorher ausgehoben und danach
wieder zugeschaufelt haben.
- Turmwächter.
Auf dem Stadtturm postiert, trommelte er nachts alle Stunden aus
und war für die Brandwache zuständig. Bei Feuer läutete
er die Sturmglocke. Auch das Morgen-, Mittag- und Abendläuten
gehörte zu seinen Pflichten.
- Vogelfänger.
Es war ein Beruf der Ärmsten. Sie fingen mit Lockvögeln,
Fallen und Leimruten ("Zeisichtuppen") Vögel und
verkauften sie.
- Wagner oder
Stellmacher waren die Autobauer und KfZ-Mechaniker
des Mittelalters. Sie stellten Räder, Wagen und Kutschen her
und reparierten diese auch in ihrer Stellmacherei. Später waren
sie hauptsächlich in landwirtschaftlichen Betrieben tätig
und mussten die Erntemaschinen instand halten.
- Walker bediente
die Walkmühle, die von einem Wasserrad angetrieben wurde. In
der Walkmühle wurde das Wollgewebe geklopft, bis es verfilzte
und reißsicherer wurde.
- Wegmacher.
Die geschotterten Wege wurden von ihm saubergehalten und gepflegt.
Seine gebräuchlichsten Arbeitsgeräte waren Zweiradkarren,
Schaufel, Besen und Kotkrücke.
- Wasserträger
waren im 18. Jahrhundert notwendige Dienstleister für die Wasserversorgung
einer Stadt. Einer von ihnen, der bekannte volkstümliche Hamburger
Johann Wilhelm Bentzel, wurde als die Figur „ Hummel“
bekannt. Er wurde wiederholt von Straßenkindern mit "Hummel
Hummel" bespöttelt und antwortete mit einem grimmiges
"Mors Mors".
- Wollwäscher
und Kämmer bereitete die Wolle handgerecht
und knotenfrei zum Spinnen vor.
- Zentralheizungs- und
Lüftungsbauer sind jetzt Anlagenmechaniker
für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik.
Die alte Berufsbezeichnung wurde durch die unsinnige Zusammenlegung
mit dem Gas- und Wasserinstallateur abgeschafft.
- Zundermacher.
Ein großer Baumpilz, der manchmal auf Nussbäumen wächst,
wurde gekocht, geklopft, "gedehnt" und wie Leder "gereckt".
Daraus konnte man Kappen oder auch Zierstücke für Jacken
herstellen. Die Abfälle wurden als Zündzunder verwendet.
|