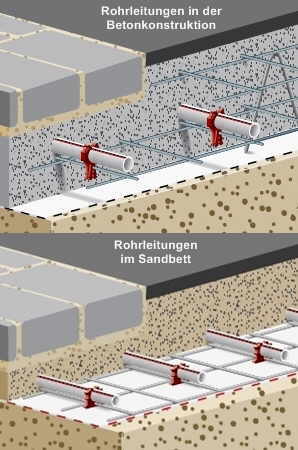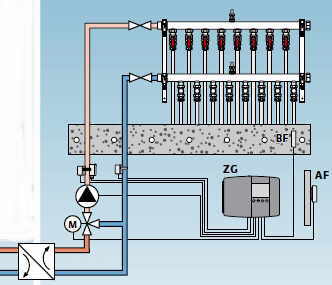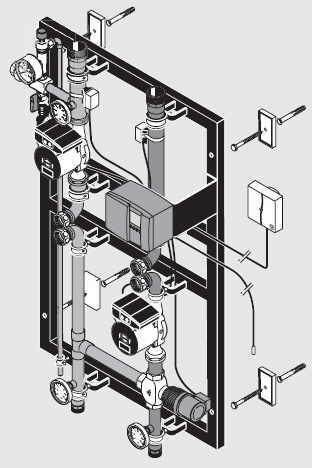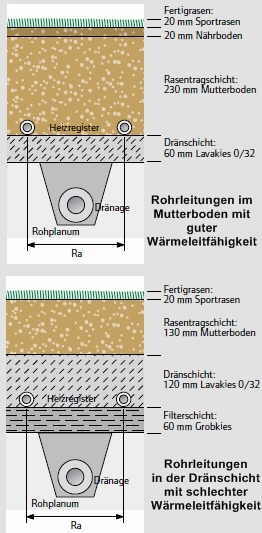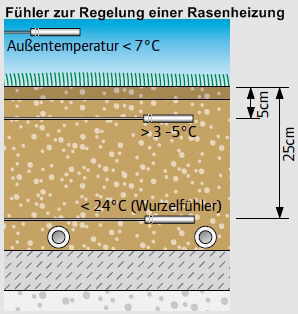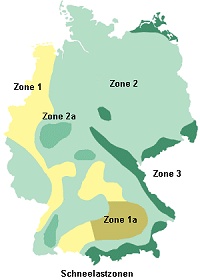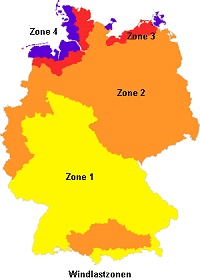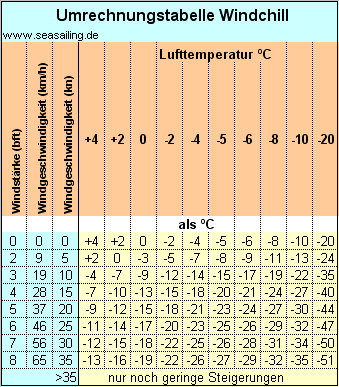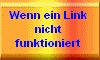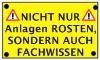Flächenheizungen
bieten sich geradezu an, die Funktionalität und
Sicherheit von Verkehrsflächen
(Gehwege, Zufahrten von Gebäuden und Hofflächen, Parkplätze,
Auf- und Abfahrrampen), Sicherheitsbereiche (Feuerwehr-
und Krankenhauszufahrten, Hubschrauberlandeplätze,Verkehrsbauten)
und Freiflächen (Fußballstadion) während
der Winterperiode zu gewährleisten. Außerdem
besteht eine Verkehrssicherungspflicht,
also die Pflicht, Gefahrenquellen abzusichern.
|
Eis-
und Schneefreihaltung
von Verkehrswegen |
Um Verkehrsflächen
(Gehwege, Zufahrten von Gebäuden und Hofflächen, Parkplätze,
Auf- und Abfahrrampen) und Sicherheitsbereiche (Feuerwehr-
und Krankenhauszufahrten, Hubschrauberlandeplätze, Verkehrsbauten)
in den Wintermonaten Eis- und Schneefrei
zuhalten, ohne Einsatz von Maschinen, Personal und schädlicher
Chemikalien dauerhaft begeh- und befahrbar
zu halten, werden Flächenheizungen eingesetzt.
Diese werden durch Rohrleitungen, wie sie bei Fußbodenheizungen
eingesetzt werden, die mit einem Wasser-Glykol-Gemisch
gefüllt sind, betrieben. Elektroheizmatten sollten,
wenn überhaupt, nur für kleine Flächen
angewendet werden. |
Es werden immer
wieder Systeme mit elektrischer Energie zur direkten
Beheizung von Verkehrswegen eingesetzt, weil sie im Vergleich
zur Beheizung mit einem Wasser-Glykol-Gemisch betriebenen Anlagen niedrigere
Investitionskosten haben. Hier werden aber die zu erwartenden
Betriebskosten und die Haltbarkeit der Elektroheizleiter unter Einfluss
größerer Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit nicht beachtet.
Außerdem sollte Strom aus Umweltschutzgründen
zur direkten Beheizung nicht eingesetzt werden |
Die Systeme
zur Eis- und Schneefreihaltung sollten
eine Energieversorgung aus Fernwärme
oder alternative Energie (z. B. Erdwärme, Geothermie,
Abwärme von Biogasanlagen, BHKW und Produktionsanlagen, Fortluftwärmepumpen)
haben. Außerdem ist eine fachgerechte Planung und Auslegung notwendig.
Dabei müssen folgende Randbedingungen abgeklärt
werden. |
-
Zuerst muss festgelegt werden,
ob eine Frostfreihaltung und/oder Schneeabtauung vorgenommen werden
soll.
-
Die zu erwartenden Klima-,
Witterungs- und Wetterbedingungen sind von geografische Lage (Windeinfluss
und die Niederschlagswerte) der Anlage abhängig.
-
Um den Wärmeverlustes
an den Untergrund zu berechnen, müssen der Untergrund und der
Grundwassereinfluss über ein Bodengutachten bekannt sein bzw.
untersucht werden.
-
Damit die Temperaturverteilung
in der Fläche festgelegt werden kann, muss die passende baukonstruktive
Gestaltung gewählt werden.
-
Weil der Energieträger
einen großen Einfluss auf die Systemtemperaturen und die Betriebsführung
hat, muss dieser bestimmt werden.
-
Am Ende wird ein geeignetes
System gewählt und es werden Anschlussleitungen, Sperrzeiten
und die Aufheizzeiten festgelegt.
|
Das Heizsystem,
das eingesetzt werden soll, ist abhängig davon, ob ob nur eine
Oberfläche oder eine Fläche
(z. B. Parkplatz) bzw. ein Bauteil (z. B. Verladerampe)
mit einem größeren Volumen erwärmt werden soll. Es ist
also festzulegen, ob es sich um eine Oberflächenheizung
oder Speicherheizung handeln soll. |
Bei einer Oberflächenheizungen
werden Strahlungsheizungssysteme oberhalb der Fläche
oder oberflächennahe Systeme in der zu beheizenden
Fläche voraus. Bei dieser Bauweise verringert sich die bei Speicherheizungen
zu berücksichtigende und zu Speicherverlusten führende Trägheit.
Bei den Speichersystemen, die tiefer unter der Oberfläche
angeordnet sind, erwärmt sich eine relativ große
Speichermasse. |
Die
Funktion der Eis- und Schneefreihaltung ist von der
einwandfreien Abführung des Schmelzwassers
abhängig. Damit das Wasser zügig abgeführt werden kann,
müssen ausreichende Wasserabläufe eingeplant
werden. Diese müssen so angelegt werden, dass das Wasser nicht
zu den kalten Rändern der Fläche abläuft,
damit es dort nicht zur Eisbildung kommen kann. |
|
|
| Anlagenschema
mit Systemtrennung |
Quelle:
Uponor GmbH |
|
Unterhalb der
eis- und schneefrei zu haltenende Fläche werden Rohrleitungen
aus PE-Xa (17 x 2 mm oder 25 x 2,3 mm)
mit einem Wasser-Glykol-Gemisch verlegt.
Normalerweise beträgt der Glykolanteil ca. 30 % und
ist dadurch bis zu Außentemperaturen
von -20 °C abgesichert. Das Frostschutzmittel
sollte lebensmittelecht (z. B.
Antifrogen L) sein, damit bei einer möglichen Leckage
das Grundwasser nicht verunreinigt wird.
|
Das Heizregister
sollte Rohrabstände von 15
bis max. 30 cm haben. Dabei gilt auch
hier die Regel, wie bei den üblichen Flächenheizungen,
je geringer der Rohrabstand ist, desto gleichmäßiger
ist die Temperatur an der Oberfläche. Bei zusätzlichen
Oberbelägen (z. B. Asphalt oder Kies), verringert
sich die Wärmeabgabe bzw. muss die Systemtemperatur
erhöht werden. Um Wärmeverlusten
nach untern ins Erdreich zu mindern, sollte unter den
Rohrleitungen eine feuchtigkeitsbeständige
Wärmedämmung eingebracht werden. |
Der Tragbeton,
in dem die Heizregister verlegt werden, muss den statischen
und konstruktiven Anforderungen sowie mindestens der Festigkeitsklasse
B 25 nach DIN 1045 entsprechen. Die PE-Xa Rohre können
keine statische Funktion übernehmen. |
Die Deckschicht
(Verschleißschicht) besteht in
der Regel aus zementgebundene Hartstoffestriche mit den
jeweiligen Schichtdicken nach den Beanspruchungsgruppen
(DIN 18560 Blatt 5). |
Die Deckschicht,
z. B. einer Fahrbahn oder Rampe,
ist entsprechend den zu erwartenden Belastungen zu berechnen.
Die Trägermatte kann in die Berechnung mit einbezogen
werden. Bei Asphaltdecken ist sicher zustellen, dass kein
heißer Asphalt an die Rohrleitungen gelangt (z.
B. durch Anordnung eines Schutzestrichs). |
Durch die Verwendung
von chemischen Zusätzen
im Rohrregister werden die Heizkreise
durch einen Wärmetauscher (Systemtrennung)
vom Wärmeerzeuger bzw. von dem restlichen Heizsystem
getrennt. Das Rohrnetz und die Umwälzpumpe im Sekundärkreis
müssen auf das verwendete Wasser-Glykol-Gemisch ausgelegt
werden, da sich die Flüssigkeit aufgrund der Viskosität
(Zähigkeit), temperaturabhängige Dichte und
die spezifische Wärmekapazität gegenüber
Wassersystemen erheblich anders verhalten. Die Systeme
für Wasser-Glykol-Gemische werden gegenüber
wasserführenden Systemen mit größeren
Dimensionen und kürzeren Heizkreisen ausgelegt. |
|
|
Eine
Regelgruppe für eine Freiflächenheizung
sollte Temperatur- und Feuchtefühler
enthalten, damit über ein angesteuertes Durchgangsventil
der primärseitigen Durchfluss
in Abhängigkeit der erforderlichen Heizwärmestromdichte
beeinflusst werden kann. |
Der Einschaltzeitpunkt
der Anlage wird über das Erreichen einer
am Regler einzustellenden Außentemperatur
definiert (erster Temperaturschwellenwert),
bei deren Unterschreitung eine Frostgefahr
wahrscheinlich ist. In der Regel können
bei Schneefall eine Außentemperatur
von weniger als –5 °C angenommen werden.
Über einen Bodenfühler wird die oberflächennahe
Temperatur der Freifläche kontrolliert.
Hierzu ist ein zweiter Temperaturschwellenwert
zur Regelung der Anlage festzulegen. Der Bodenfühler
sollte leicht ausgetauschbar und an einer für
die eis- und schneefrei zu haltende Freifläche
relevanten Stelle angeordnet sein.
|
Glatteis
bildet sich normalerweise im Außentemperaturbereich
zwischen 0 °C und -6 °C. Aber wenn eine
Fläche noch unter 0 °C liegt, so kann
auch bei höheren Außentemperaturen
bei Regen eine Eisbildung stattfinden. Deswegen
sollte zur Temperaturmessung immer eine Feuchtemessung
durchgeführt werden. |
| Besonders
bei Speichersystemen sollte eine
Mindestheizzeit eingestellt werden,
damit nach dem Abtauen eine schnelle Wiedervereisung
vermieden wird. Problematisch kann die Trägheit
des Systems sein, weil sich abzeichnender Gefahr
von Frostbildung oder Schneefall die Anlage zunächst
ausgeschaltet bleibt und bei tatsächlich
aufkommenden Schneefällen oder Blitzeis die
Anlage dann in sehr kurzen Zeiten ausreichend
hohe Oberflächentemperaturen erzeugt, um
drohende Eis- und Schneeglätte zu vermeiden. |
|
|
| Uponor-Zentral-Regelstation
mit integriertem Regler 3D für die Schnee-
und Eisfreihaltung von
Freiflächen |
| Quelle:
Uponor
GmbH |
|
|
|
|
|
Rasenheizungen
werden hauptsächlich in Sportstadien eingebaut,
um die Rasenflächen eis- und schneefrei
zu halten. Schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts
wurden in den ersten Stadien Rasenheizungen eingebaut. Inzwischen
müssen die Fußballstadien der 1.
und 2. Liga mit einer Rasenheizung ausgestattet werden.
|
Bei der Nachrüstung
einer Rasenheizung werden die Rohre mit speziellen Geräten,
wie sie bei dem Einziehen der Dränrohre in Ackerland in
Nassgebieten benutzt werden, in die Rasendecke eingezogen.
Dies ist jadoch nur möglich, wenn das später abtauende
Wasser von der Spielfläche abgeführt
werden kann. Wenn die Rasenfläche keine Dränage bzw.
ausreichendes Gefälle (zwischen 0,5 % und 1 %) hat, muss
vorher eine Sanierung des Platzes stattfinden. Außerdem
müssen die Rohre ausreichend tief eingebettet
werden, damit sie bei der Rasenpflege (Bodenlockerung) und Spielfeldmarkierung
nicht beschädigt werden. Damit die Gefahr eines „Verbrennens”
der Rasenwurzel vermieden wird, dürfen die Rohrleitungen
nicht zu dicht an der Oberfläche verlegt sein, da die Anlagen
mit Temperaturen bis zu 40 °C gefahren werden. |
Die Probleme, die bei einer Nachrüstung
einer Rasenheizung bestehen, sollten bei einem Neubau
ausgeschlossen werden. Hier sollten die Landschaftsarchitekten
und Heizungs-Fachplaner schon bei der Planung
zusammenarbeiten. Gefordert wird eine
strapazierfähige und pflegeleichte
Rasendecke und ein energiesparender Betrieb
der Anlage. |
|
Anordnung
der Rohrleitungen |
Quelle:
Uponor GmbH |
|
| Bei der Anordnung
der Rohrleitungen wird zwischen
zwei Varianten unterschieden. Bei
der thermisch günstigen Variante
werden die Rohrleitungen (Heizregister)
im Mutterboden verlegt, da dieser
eine gute Wärmeleitfähigkeit
hat. Ungünstiger ist das Verlegen
der Rohrleitungen in der Dränageschicht.
|
Der Aufbau
einer Rasenheizung sollte so geplant werden, dass
eine gute Wärmeleitung von
dem Heizregister bis zur Oberfläche
vorhanden ist, denn nur dadurch können niedrige
Systemtemperaturen und ein schnelles Aufheizen gewährleistet
werden. Außerdem sollte die Rohrüberdeckung
so gering wie möglich sein. Unter dem Heizregister
sollten möglichst wärmedämmende
Schichten angeordnet werden, damit der
Wärmetransport in grundwasserdurchsetzte
Erdreich vermindert wird. |
Bei der Planung
einer Rasenheizung ist besonders auf die regionalen
Gegebenheiten vor Ort geachtet werden.
So hat z. B. das Wetter, die
Verschattung und Windanfälligkeit
des Rasens einen großen Einfluss auf die Auslegung
der Heizkreise.
|
Eine Rasenheizung
sollte nicht für extrem
niedrige Außentemperaturen ausgelegt
werden, da starke Schneefälle selten bei tiefen
Temperaturen (erheblich unter 0 °C) auftreten. |
In jedem
Fall sollte eine gute Wärmeleitung
von der Ebene der Rohrregister bis zur Oberfläche
vorhanden sein. Dann gelten folgende wärmetechnische
Parameter der Schnee- und Eisfreihaltung
von Rasenflächen: |
Stationäre Aufheizleistung
etwa 150 W/m2
Dynamische Aufheizleistung
bis etwa 250 W/m2
Vor- und Rücklauftemperatur
etwa 40 °C / 30 °C
|
|
|
Damit an der Oberfläche
keine zu große Temperaturwelligkeit auftritt,
sollten die Rohrleitungen mit einem Verlegeabstand
< 30 cm und eine Tiefe
zwischen 25 bis 30 cm verlegt werden. Bei größerenen
Abständen besteht die Gefahr der Teilvereisung an der Oberfläche
zwischen den Rohren. |
|
Anordnung
der Rohrleitungen |
Quelle:
Uponor GmbH |
|
| Die Regelung
der Eis- und Schneefreihaltung
für Rasenflächen muss
besonders sorgfältig ausgewählt werden.
Das Ein- und Ausschalten
und die richtige Wahl der Systemtemperaturen
der Anlage muss genau eingehalten werden.
|
Die Systemtemperaturen
sind das kleinere Problem, weil sie in Abhängigkeit
zur Außentemperatur werden.
geregelt, Dabei ist nur die maximale Temperatur
an der Grasnarbe zu begrenzen,
damit es nicht zur Überhitzung
der Rasenwurzel kommt. Hierzu werden
ein Fühler ca. 3 bis 5 cm unter der Grasnarbe
und ein weiterer Fühler ca. 25 cm tief im Erdreich
als Wurzelfühler vorgesehen.
Natürlich sind bei
großen Flächen (z. B. Fußballstadien)
mehrere Fühlerpaare vorzusehen. Durch diese
Anordnung kann die Einwirkung des
Emitters (Teil eines Transistor) auf die Oberfläche
bzw. Reaktionszeiten festgestellt
werden, was für ein rechtzeitiges Einschalten
vor einer anstehenden Nutzung der Rasenfläche
von Bedeutung ist. Die gemessenen Parameter können
dann adaptiv auf das Regelsystem einwirken. |
Ein besonderes
Problem der Regelung ist das Anzeigen
bzw. die Meldung des Auftretens von Eis-
oder Schneeregen. Hier hat sich
das System "Eis- und Schneemelder"
der Firma Tekmar bewährt. Dieses System gibt
es in analoger und digitaler
Ausführung.
|
|
|
|
|
Ein besonderes Problem
der Regelung bei der Eis- und Scheefreihaltung
von Freiflächen, Verkehrswegen, Rasenflächen, Dachrinnen
und Satellitenanlagen ist das Anzeigen bzw.
die Meldung des Auftretens
von Eis- oder Schneeregen.
Hier hat sich das System der Firma Tekmar bewährt. Dieses
System gibt es in analoger und digitaler
Ausführung. |
Der Eis- und
Schneemelder schaltet im Bedarfsfall die Freiflächenheizung
oder eine Warneinrichtung ein. Eine einstellbare
Mindestheizzeit verhindert nach dem Abtauen eine zu schnelle
Neuvereisung und erhöht dadurch die Sicherheit. Die Werte
der Einstellungen für Mindestheizzeit,
zwei Temperaturschwellen und die Feuchteempfindlichkeit
werden im Display angezeigt. Zusätzliche Anzeigenebenen
geben während der Inbetriebnahme und im Servicefall Auskunft
über die Einstellungen und das Verhalten der Anlage. |
|
| |
|
Eisfühler |
Quelle:
Tekmar GmbH |
|
|
| Funktionsbeschreibung
|
Abhängig
von der Bodentemperatur und dem
Zustand der Eisfühleroberfläche
(trocken; feucht) wird unter 3 Hauptbetriebsarten
unterschieden: |
1. Wenn die
Bodentemperatur größer als der eingestellte
Sollwert von "Temperaturschwelle 1“ ist,
steht das System in Bereitschaft. Die Eisfühlerheizung
wird nicht aktiviert, der Zustand der Eisfühleroberfläche
hat keinen Einfluß auf den Eismelder. Mit
der Taste "Anzeige" kann die aktuelle
Fühlertemperatur „T1 x°C“ abgefragt
werden.
2. Wird die Bodentemperatur kleiner als der eingestellte
Sollwert von "Temperaturschwelle 1" und
die Oberfläche des Eisfühlers bleibt ohne
Feuchtebelag, wird das System aktiviert. Unter der
Beschriftung "TF1" ist ein Anzeigebalken
im Display zu erkennen. Mit der integrierten Eisfühlerheizung
wird die Fühleroberfläche auf den eingestellten
Wert von "Temperaturschwelle 1" konstant
gehalten. Im Display erscheint bei aktiver Fühlerheizung
ein Anzeigebalken über dem Schriftzug "Fühler".
3. Bildet sich während der Betriebsart 2 ein
Feuchtebelag, die Erkennung von Feuchte wird durch
einen Anzeigebalken über dem Schriftzug "Feuchte"
im Display angezeigt, auf der Eisfühleroberfläche,
wird der Relaisausgang "Relais 1" für
die eingestellte Mindestheizzeit eingeschaltet.
Dies ist durch einen Anzeigebalken unter dem Schriftzug
"R1" im Display zu erkennen. Die Fühlerheizung
wird außer Betrieb gesetzt, damit der Fühler
die Bedingungen der umgebenden Fläche annimmt
und sich nicht selbst trocken heizt. Falls die Fühlertemperatur
unter -2°C absinkt, wird die Fühlerheizung
wieder aktiviert. Der Eisfühler wird, um bei
starken Temperatureinbrüchen schneller reagieren
zu können, auf dieser Temperatur gehalten.
|
|
|
| Fällt
Schnee auf die Eisfühleroberfläche oder bildet sich
Eis oder Reif, wird dieser angetaut. Es bildet sich zwischen
den beiden Feuchte-Elektroden ein Feuchtebelag, welcher das
System unverzüglich in die Betriebsart 3 umschaltet. Nun
wird der Betrieb der Fühlerheizung aus- und der Betrieb
der Freiflächenheizung für die Mindestheizzeit eingeschaltet.
Der Eisfühler übernimmt wieder die Messung der Bodentemperatur.
|
Sollten
am Ende einer Mindestheizzeit die Bedingungen "Temperatur
und Feuchte" nach wie vor vorhanden sein, wird die Mindestheizzeit
erneut aktiviert, ohne den Betrieb der Freiflächenheizung
zu unterbrechen. Quelle:
Tekmar GmbH |
| . |
Für
jeden Einsatzbereich gibt es spezielle Eis-
und Schneemeldesysteme. Diese erfassen mindestens die
Temperatur (T-System) und auch die Feuchtigkeit
(TF-E und TF-S) und es ist nur ein Kombi-Sensor
ist zur Messung von Temperatur und Feuchte notwendig. Alle Systeme
schalten nur bei Bedarf den zu beheizenden Bereich ein. Bei
den TF-Systemen kann eine Mindestheizzeit vorgewählt werden.
Besteht aufgrund ausreichender Temperatur (T- und TF-System)
bzw. Trockenheit (TF-System) keine Frostgefahr mehr, wird die
Heizung unverzüglich abgeschaltet. |
| |
| T-System
(Temperaturmessung) |
Quelle:
Tekmar GmbH |
|
Das T-System
ist ein kostengünstiges System,
das das Heizsystem bis - 25 °C
misst und einschaltet. Das System bleibt dauerhaft
eingeschaltet bis die vorher eingestellte höhere
Umgebungs- oder Flächentemperatur (z. B. +
1° C) erreicht ist. Zu dem T-System gehören
ein Steuergerät und ein Temperatur-Sensor.
|
Es stehen
2 Steuergeräte zur Auswahl,
das einfache Gerät ist zum Einsteller der Einschalttemperatur
über einen Drehsteller vorgesehen und hat einen
Alarmausgang zur Weitermeldung eines Sensorfehlers.
An dem anderen Gerät kann die Schalttemperatur
über einen Drehsteller eingestellt werden,
zeigt die Schalttemperatur
und Ist-Temperatur (Umschaltung durch Taste) über
eine 2-stellige 7-Segment-LED-Anzeige an und hat
einen Alarmausgang zur Weitermeldung eines Sensorfehlers. |
| Ein stabförmiger
Sensor (Messing,
voll vergossen) wird für die Messung von Temperaturwerten
in Dachrinnen und an anderen frostgefährdeten
Bereichen eingesetzt. Die kompakte Bauform ist mit
einem axialen Kabelanschluss und Schraubbolzen zur
Fixierung ausgestattet..
|
|
|
|
|
| TF-E-System
(Temperatur- und Feuchtemessung - Eco) |
Quelle:
Tekmar GmbH |
|
Das wartungsfreie
TF-E-System kann für Freiflächen
und an anderen frostkritischen Stellen
eingesetzt werden (z. B. in Dach-/Regenrinnen, auf
Satellitenanlagen, Flachdächern, Windrädern).
|
Das Steuergerät
ist zum Anschluss von ein oder zwei Temperatur-
und Feuchte-Sensoren geeignet. Beide Sensoreingänge
sind für die Temperaturmessung oder für
die kombinierte Messung (Feuchte und Temperatur)
konfigurierbar. Die Funktionen und die Kontrolle
aller Parameter und Messwerte erfolgt über
ein Display und drei Menütasten. Außerdem
hat das Gerät eine Leuchtdiode ist zur Anzeige
des aktuellen Betriebszustands und einen Alarmausgang
zur Weitermeldung eines Sensor- oder Funktionsfehlers. |
| Bei diesem
System können verschiedene Sensoren
eingesetzt werden.
|
|
|
| |
| TF-S-System
(Temperatur- und Feuchtemessung - sensitiv) |
Quelle:
Tekmar GmbH |
|
Das sensitive
TF-S-System wird eingesetzt, wenn eine
hohe Sicherheit und eine schnelle Reaktionsfähigkeit
gewünscht wird. Das System wird hauptsächlich
bei Freiflächen, (z. B. öffentliche und
private Tiefgaragen-Einfahrten, Bahnsteigtreppen,
Haltestellen, Hubschrauber-Landeplätze, Parkplätze)
eingesetzt..
|
Zu diesem
System gehören ein Steuergerät
mit Netzteil und verschiedene Sensoren
(Temperatur- und Feuchte-Sensor und einem optionalen
Temperatur-Sensor) Die Funktionseinstellung
und die Kontrolle aller Parameter und Messwerte
sind über vier Drehsteller (davon 3 verdeckt)
und drei Menütasten eingestellt und werden
im Display angezeigt . Auch dieses Gerät
hat einen Alarmausgang zur Weitermeldung eines Sensor-
oder Funktionsfehlers. |
|
|
. |
|
|
|
|
Dachflächenheizung |
|
Rohrleitungen
bei großen Flächen
|
Quelle:
Uponor GmbH |
|
Dachlawinen
und Eiszapfen führen immer
wieder zu schweren Unfällen, die Personen-
und Sachschäden verursachen. Auch liest man
immer wieder von eingestürtzten Flachdächern.
|
Besonders
in schneereichen Zeiten wird auch immer wieder
über das Freischaufeln von
Dachflächen berichtet. Aber durch die Konstruktion
der Dächer (Steilheit, Belastungsgrenzen)
ist diese Art der Beseitungung des Schnees nicht
überall möglich bzw. zu gefährlich.
|
Damit
es nicht zu den o. g. Problemen kommen kann, werden
die gefährdeten Dächer
oder Dachteile beheizt.
Normalerweise verwendet man elektrische Heizleiterschleifen,
selbstregulierendem Heizbander oder
für große Flächen elektrische
Heizmatten. Aber auch Wassersysteme
mit Frostschutzmittel, wie sie für
Freiflächenheizungen (Parkplätze, Auffahrampen,
Gehwege, Rasenflächen) eingesetzt werden.
> mehr |
|
|
|
Dachrinnenheizung |
| |
Wenn ein
Dach nicht schneefrei ist, dann
können die Wärmeabgabe von den Gebäuden im
Dachbereich oder die Sonneneinstrahlung bei Frost
zu Schmelzwasser führen.
Das Wiedergefrieren dieses Schmelzwassers in den
Dachrinnen, Fallrohren oder in Dachüberstandsbereichen
kann zu einer gefährlichen Eiszapfenbildung,
Wasserrückstau und Schäden an den Entwässerungseinrichtungen
oder dem Gebäude führen.
Durch die Beheizung der kritischen Bereiche, so
z. B. die Dachrinnen und Regenfallrohre, können
Schäden zuverlässig verhindert werden.. >
mehr |
|
|
|
Verkehrssicherungspflicht |
Die Verkehrssicherungspflicht
ist die Pflicht zur Sicherung von Gefahrenquellen.
Bei Nichtbeachtung dieser Pflicht kann es zu Schadensersatzansprüchen
kommen. Verkehrssicherungspflichten sind sind in den meisten
Fällen gesetzlich nicht geregelt,
sie sind von der Rechtsprechung über Gerichtsurteile
entwickelt worden. |
| Verkehrssicherungspflichtig
ist, |
• wer eine Gefahrenquelle schafft
oder unterhält
• wer eine Sache betreibt, die für Dritte gefährlich
werden kann
• wer gefährliche Sachen dem allgemeinen Verkehr
aussetzt oder in Verkehr bringt |
Von einem Verkehrssicherungspflichtigen
wird nicht erwartet, dass er die Gefahrenquelle gegen
alle denkbaren Schadensfälle absichert, er muss aber
alle Vorkehrungen gegen voraussehbare Gefahren treffen,
die durch eine gewöhnliche bzw. bestimmungsgemäße
Benutzung eintreten können. |
Bei Gewerbebetrieben
wird der Inhalt der zu beachtenden Verkehrssicherungspflichten
durch die Unfallverhütungsvorschriften
genauer festgelegt. Ein Verstoß gegen die Vorschriften
ergibt immer ein Verschulden. |
Die Verkehrssicherungspflicht
kann auch auf Dritte Personen übertragen
werden. Diese Übertragung muss aber regelmäßig
überwacht werden. |
Besonders wichtig
ist diese Pflicht z. B. in den Wintermonaten.
Hier gibt es in vielen Fällen die auf Anwohner übertragene
Streupflicht. Diese beginnt nicht mit
dem Ende des Schneefalls, sondern erst nach einer angemessenen
Wartezeit. |
| Aber auch der Schutz
gegen Dachlawinen und Eiszapfen
ist ein immer wieder auftretendes Problem. Hier kann durch
Schneefangsysteme, Dachflächen- und Dachrinnenheizungen
vorgebeugt werden. Aber die Verkehrssicherungspflicht
kann auch durch eine einfache Absperrung
bzw. Hinweise erfüllt werden. >
mehr |
|
|
|
|
| |
Besonders durch
Schneelasten kommt es immer wieder zu Schäden
an Gebäuden und hier speziell an Dächern. Die
Druckbelastung (Flächenlast), die
durch den Schnee entstehen kann, wird immer noch unterschätzt.
Die Schneelasten sind von der Klimazone
und die Höhenlage abhängig. Das
Schneeklima wird von der Firma C. Killet in einer Schneelastzonenkarte
erfasst, welche die Schneeintensität für verschiedene
geographische Regionen angibt. |
| In Deutschland gibt
es die Zonen 1 bis 3 und die Zonen 1a und 2a. Die Schneehöhe
ändert sich überproportional zur Höhenlage,
deshalb muss auch diese Einflussgröße berücksichtigt
werden. Bei der Berechnung der Dachstatik
und bei der statischen Dimensionierung von Solarthermie-
und Photovoltaikanlagen ist die Schneelast
neben der Windlast ein wichtiger Berechnungsfaktor. |
| Schneeart |
Dichte
(kg/m3) |
| trockener
Pulverschnee |
30
bis 50 |
| normaler Neuschnee |
50
bis 100 |
| feuchter Neuschnee |
100
bis 200 |
| trockener
Altschnee |
200
bis 400 |
| feuchter Altschnee |
300
bis 500 |
| Firn |
500
bis 800 |
|
|
|
|
| Windlast |
Die Windlast hat einen Einfluss auf
Gebäude oder Bauteile. Die Windströmung
beaufschlagt ein Gebäude mit einem Winddruck, der
auf der Luv-Seite einen Überdruck
und auf der Lee-Seite einen Unterdruck
aufbaut. In wie weit sich die Windlast auf ein Gebäude
auswirkt, hängt von dem Standort mit dem örtlichen
Windklima und der topographische Lage ab. Das Windklima
ist von der Firma C. Killet in einer Windzonenkarte
erfasst. Darin sind über einen langen Zeitraum gemittelte
Windgeschwindigkeiten für verschiedene geographische
Regionen als Windlastzonen dargestellt.
In Deutschland gibt es die Windlastzonen 1 bis 4. Die
Windlast muss bei der Planung in die statische Berechnung
von Windkraft- und Solaranlagen
eingehen.
|
. |
| |
|
|
|
|
Windchill
- Windkühle - gefühlte Temperatur |
|
|
Quelle:
Kasper & Richter GmbH & Co. KG |
|
Der Windchill
(Windchill-Effekt) ist eine meteorologische Größe
(Windchilltemperatur - WCT),
die die Außentemperatur, Windgeschwindigkeit
und Luftfeuchte beinhaltet. Besonders im
Winter wird bei stärkerem Wind die Temperatur deutlich
niedriger empfunden als sie tatsächlich ist. Deswegen
wird der Windchill auch "gefühlte Temperatur"
genannt. In den meisten Wetterberichten bzw.
Wettermeldungen wird inzwischer dieser Wert mit
angegeben. |
Die WCT
gibt eigentlich nur die Wärmeverlustrate
an, die eine dem Wind ausgesetzte Hautfläche
hat. Dabei geht man davon aus, dass der Wärmeverlust
der Haut bei Wind größer gegenüber der Windstille
ist. |
Eigentlich hat der
Windchill nur in sehr kalten und stürmischen
Gegenden (Arktis, Antarktis, Meeresküste,
Hochgebirge) eine aktuelle Bedeutung. Aber auch, wenn Menschen
einer hohen Windgeschwindigkeit ausgesetzt
sind, wie z. B. beim Sport (Skilaufen,
Eislaufen, Windsurven, Kiten, Strandsegeln), ist WCT von
Bedeutung, da man sich durch entsprechende Kleidung
vor einer Auskühlung schützen
kann. Hier gibt es Windmessgeräte,
die die vor Ort gemessenen Daten umrechnen und anzeigen.
Aber auch jede gute Wetterstation zeichnet die WCT-Daten
auf. |
|
|
Eine aus einer umfangreichen Formel
hergeleiteten Kurzformel berücksichtigt nur die
tatsächliche Temperatur und die Windgeschwindigkeit und ist dadurch
nur eine überschlägige Berechnung. |
Twc = 33 + ( 0,478 + 0,237
* SQRT(vw) - 0,0124 * vw ) * ( T - 33 )
|
- Twc - Windchill-Temperatur
- °C
- T - tatsächliche Temperatur
- °C
- vw - Windgeschwindigkeit
- km/h
- SQRT - Quadratwurzel
|
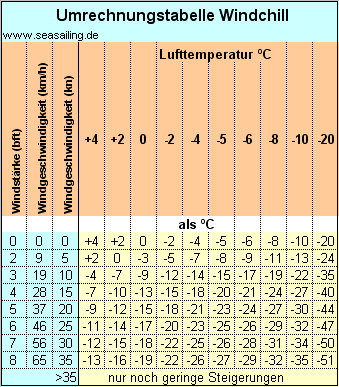 |
Windchilltemperaturen |
Quelle:
Seasailing |
|
|
|
| . |
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
| . |
Hinweis!
Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen, dass von meiner Website
aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung
eines unnötigen Rechtsstreites, mich
umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit
zügig Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis:
Das zeitaufwändigere Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung
einer für den Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht
nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen. Die Kostennote
einer anwaltlichen Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit
mir wird daher im Sinne der Schadensminderungspflicht als unbegründet
zurückgewiesen. |
| |
|
| Videos
aus der SHK-Branche |
SHK-Lexikon |
|
|

|
|