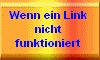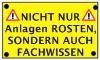Der Hintergrund für
die Entwicklung eines neuen Konzeptes der Heizkörperauslegung
nach der VDI 6030 "Auslegung von freien
Raumheizflächen – Blatt 1: Grundlagen und Auslegung
von Raumheizkörpern" ist die thermische
Behaglichkeit.
Da mit der immer mehr
sinkenden Norm-Raumheizlast Lastschwankungen auftreten
und die Nutzer auf die bessere Dämmung z. B. mit leichterer Kleidung
und damit eine größere Empfindlichkeit gegenüber Temperaturunterschieden
und Luftströmungen reagieren, wurde es erforderlich, die Raumheizflächen
so auszulegen, dass die Behaglichkeitsdefizite (z. B. Strahlungsdefizite
und Fallluftströmung
an Außenflächen) beseitigt werden. Dabei müssen die Anordnung,
Abmessung und Temperaturen der Heizkörper danach abgestimmt werden.
Die Heizkörperauswahl
nach der VDI 6030 wird nicht nach einer
gleichen Spreizung durchgeführt. Die Heizkörpergröße
wird nach der vorhandenen Fensterbreite und Brüstungshöhe festgelegt.
Die Übertemperatur der Heizkörper wird durch eine Strahlungsbilanz
bestimmt, wobei der "Strahlungsentzug" kalter Außenflächen
durch die "Strahlungslieferung" des Heizkörpers kompensiert
wird. Dadurch ergeben sich in jedem Raum unterschiedliche Rücklauftemperaturen
aus der geforderten Übertemperatur und der innerhalb einer Bandbreite
festgelegten Vorlauftemperatur. Die Bautiefe des Heizkörpers
wird nach der Raumheizlast festgelegt.
Nach der VDI wird
nicht der Gesamtraum als Beheizungsziel angesehen wird, sondern nur eine
"Anforderungszone", in der sich die Personen
aufhalten. In diesem Bereich sollen die Anforderungen, besonders die Behaglichkeit,
erfüllt werden. Es dürfen also keine Behaglichkeitsdefizite
auftreten. Das bedeutet, dass die Anordnung und Größe der freien
Raumheizflächen so ausgelegt werden müssen , dass in dieser
Zone die gewünschten Anforderungen erfüllt sind. (Eine "Heizfläche"
kann auch eine Fußboden-, Wand- oder Deckenheizung , aber auch ein
Kachelofen sein).
- Bei der Anforderungsstufe 1 genügt es, dass nur die Normheizlast gedeckt wird. Hier kann also wie bisher, z. B. DIN 4701-3, geplant werden. Es werden keine besonderen Bedingungen für die Heizkörperanordnung, die Abmessungen und die Wassertemperaturen gestellt.
- Bei der Anforderungsstufe 2
muss zusätzlich ein Teil der Behaglichkeitsdefizite beseitigt
werden. In diesem Fall das Strahlungsdefizit z. B. einer " kalten"
Fensterfläche. Die Raumheizfläche sorgt dafür, dass
die Halbraumstrahlungstemperatur in Richtung der „kalten“
Umfassungsfläche sich nicht von der Auslegungs-Innentemperatur
unterscheidet.Da hier nur die Wassertemperatur zur Verfügung
steht, die aber niedriger ist als in die Stufe 1 ist, lässt sich
eine
Aufheizreserve herstellen. Hierzu kann zu Aufheizzwecken aus dem Absenk-Heizbetrieb
heraus die Vorlauftemperatur und/oder der Wasserstrom angehoben werden. - Bei der Anforderungsstufe 3 werden alle Funktionen gefordert, die eine vollständige Beseitigung der Behaglichkeitsdefizite in der Anforderungszone sicherstellen.
Damit eine richtige
Planung durchgeführt werden kann, wird nach der VDI 6030 ein
Pflichtenheft
eingeführt. Denn nur durch das Pflichtenheft können
Planungsvarianten (Angebote) verglichen werden. Außerdem lassen
sich nach der Errichtung der Heizungsanlage die Vollständigkeit und
die Erfüllung der Funktionen überprüfen. Das Pflichtenheft
ist auch ein Bestandteil des bei den Architekten üblichen Raumbuches.
Heizkörperrechner zur überschlägigen Ermittlung von Heizkörperleistungen
Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V. und BWP Marketing & Service GmbH
Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V. und BWP Marketing & Service GmbH
Neue
Wege der Heizkörperauslegung - Dipl.-Ing. Raphael
Haller
Norm-Heizlast
(DIN EN 12831)
Die Auslegungsheizlast
dient zur Auslegung des Wärmeerzeugers bzw. der Raumheizflächen
einer Heizungsanlage.
Quelle:
Recknagel/Prof. Dr.-Ing. Ernst-Rudolf Schramek |
- Wärmeverluste an die aüßere Umgebung
- Wärmeverluste durch unbeheizte Nachbarräume
- Wärmeverluste an das Erdreich
- Wärmefluss zwischen beheizten Zonen unterschiedlicher Temperatur
- Wärmeverluste durch natürliche Belüftung (durch hygienisch Mindest-Luftvolumenstrom oder durch Infiltration durch die Gebäudehülle)
- Wärmezufuhr durch mechanische Belüftung (durch Zuluftnacherwärmung und oder durch Unterdruck-Abluftanlagen)
Wärmezufuhr für Räume
mit unterbrochenem Heizbetrieb, benötig eine zusätzliche
Aufheizleistung (wird eigentlich im Wohnungsbau nicht
eingeplant, kann aber bei dem Einsatz einer Wärmepumpe notwendig
werden.)
- Himmelsrichtung
- Windanfall
- Höhe der Nachbargebäude
- geografische Lage zur Bestimmung der Abschirmungsklasse
- Baubemaßung
- Nutzungsangaben
- Temperaturangaben
- Nummerierung der Räume
- Lichte Raumhöhen
- Geschosshöhen
- Deckendicken
- Höhe der Brüstungen
.
Heizlast-Beispielberechnung ausführliches Verfahren
DIN EN 12831 Heizlast > vereinfachte Verfahren ohne Passwort (alt)
Freeware
Programmteile - mh-software GmbH
Rohrnetzberechnung
mit Beispielen und Tabellen
Heizflächenauslegung
von Ing. Dipl.-Päd. Markus Schöpf
Geschichte der Wärmebedarfsberechnung
DIN 4701 |
|
1929 |
Erste
Ausgabe im Jahre der Gründung des Fachnormenausschusses
für Heizung. Die Berechnungsgrundlagen gelten im Grunde heute
noch. Die Norm enthielt neben den Klimatafeln für eine Vielzahl
deutscher und österreichischer Orte auch umfangreiche Tabellen
von Wärmeleitzahlen von Baustoffen, Wärmedurchgangszahlen
sowie die Berechnung von Kesseln und Heizkörpern. |
1947 |
Zweite
Ausgabe. Die Angaben über Kessel und Heizkörper
wurden auf-grund der sich entwickelnden Vielfalt der Modellreihen
herausgenommen und in eigenen Normen (DIN 4702, DIN 4703) aufgenommen. |
1959 |
Dritte
Ausgabe mit der Anpassung der Wärmedurchgangszahlen
an die moderneren Baustoffe und neu entwickelte Wand- und Deckenkonstruk-tionen,
genauere Berücksichtigung des Windeinflusses und Reduzierung
der Sonderfälle. |
1983 |
Vierte
Ausgabe. Die Norm wurde erstmals geteilt in Teil 1 (Grundzüge
des Berechnungsverfahrens) und Teil 2 (Tabellenwerte, Parameter).
Die wesentlichen Änderungen betreffen die Berücksichtigung
neuer Erkennt-nisse der Gebäudedurchströmung, insbesondere
von Hochhäusern, sowie den Wegfall bestimmter Zuschläge
z.B. Betriebsunterbrechung und Himmelsrichtung bzw. Einführung
neuer Zuschläge, z.B. zur Korrektur des Wärmedurchgangskoeffizienten
k. Aufgrund der negativen Erfahrungen mit der Energiekrise bestand
des Bestreben, den Wärmeverlust physikalisch so genau wie möglich
zu berechnen und somit enthielt die Norm praktisch keine Sicherheitsreserven.
So wurde die Speicherfähigkeit des Gebäudes durch eine
Außentemperaturkorrektur berücksichtigt, die Norm-Außentemperatur
im Durchschnitt um 2 - 3 K nach oben korrigiert, die Hauskenn-größen
gesenkt und der gleichzeitig wirksame Lüftungswärmeanteil
für den Gebäudelüftungswärmeverlust eingeführt.
Im Ergebnis ergab sich eine deutlich gesenkter Wärmebedarf
von ca. 20 - 25%. |
1995 |
Normenentwurf aufgrund
der Wiedervereinigung Deutschlands. Im wesentlichen wurde Tabelle
1 der Norm-Außentemperaturen um die der neuen Bundesländer
ergänzt. Weiterhin wurde die Außentemperatur-Korrektur
aufgrund der - wie sich herausstellte - fehlenden Sicherheitsreserven
gestrichen und der Berechnungsgang für Erdreich berührte
Bauteile überarbeitetet. Der Normenentwurf wurde nur noch als
Gelbdruck veröffentlicht, da bereits das europäische Normungsvorhaben
bestand. |
| 2003 |
Einführung
der DIN EN 12831, August 2003 - Heizungsanlagen in Gebäuden
- Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast -
. Für DIN 4701 gilt - in Verbindung mit dem deutschen nationalen
Anhang, Beiblatt 1 - eine Übergangsfrist bis Oktober 2004. |
| 2008 |
DIN EN 12831 Beiblatt 1,
Juli 2008 - Heizsysteme in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung
der Norm-Heizlast - Nationaler Anhang NA |
| Quelle: Seminarteam-Hans-Markert | |
| Der
Wärmeleistungsbedarf für Raumheizung wurde bislang nach
DIN 4701-1 bis DIN 4701-3 "Wärmebedarfsberechnung"
bestimmt. Diese Norm ist durch die DIN EN 12831
in Verbindung mit der deutschen Umsetzung in Beiblatt 1
ersetzt. |
|
| Kurzer
Rückblick auf bisherige Normen |
|
| Die
"Wärmebedarfsberechnung“ wurde in der Zeit von
1929 bis 2004 in der DIN 4701 genormt. In den Ausgaben von 1929,
1944/47 und 1959 war der Berech-nungsgang nahezu identisch, nur
einzelne Randwerte für die Berechnung wurden dem Stand des
Wissens angepasst. Die 1959 berechneten Heizlasten sind leicht geringer
als die Werte von 1944/47, aber etwa 20…30% höher verglichen
mit der Ausgabe der Norm von 1983/89, da mit höheren Ansätzen
für den Luftaustausch und größeren Zuschlägen
für Räume mit kalten Wandflächen sowie niedrigeren
Außentemperaturen gerechnet wurde. |
|
| Die
Ausgabe der DIN 4701 von 1983 erfolgte zunächst in zwei Teilen
und brachte zahlreiche Änderungen (Berücksichtigung der
Bauschwere, Mindestluftwechsel, Teilbeheizung der Nachbarräume)
mit sich. Mit dem nachtäglich in Kraft getretenen Teil 3 der
DIN 4701 konnte bei der Heizflächenbemessung ein Sicherheitszuschlag
von 15% pauschal angesetzt werden, wenn der Wärmeerzeuger die
Vorlauftemperatur im Bedarfsfall nicht steigern kann. Diese Option
wurde eingerichtet, weil es in der Praxis wegen der knappen Leistungsbemessung
zur Unter-versorgung kam. |
|
Es
kann davon ausgegangen werden, dass die Leistungsbemessung nach
DIN 4701-1 und DIN 4701-2 (1983) vor Inkrafttreten des dritten Teils,
d.h. ohne 15% Zuschlag auf die Raumheizflächen, etwa das rechnerische
Minimum für die Heizlast bedeutet. Sowohl mit den Normausgaben
der früheren Ausgaben der Heizlastberechnung als auch mit der
neuen europäischen Norm ergeben sich größere Normleistungen,
also installierte Heizkörperflächen und Wärmeerzeugerleistungen.
Die bedeutet, dass die untere Leistungsgrenze für einen behaglichen
Anlagenbetrieb abgesteckt werden kann: sie liegt etwas oberhalb
der Normwerte von 1983. |
|
Quelle: Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik - Herausgegeben von Prof. Dr.-Ing. Ernst-Rudolf Schramek |
|
Hinweis!
Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen,
dass von meiner Website aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich
Sie, zur Vermeidung eines unnötigen Rechtsstreites, mich
umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit zügig
Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Das zeitaufwändigere
Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung einer für den Diensteanbieter
kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen
Willen. Die Kostennote einer anwaltlichen
Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne
der Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen.