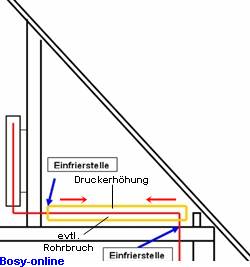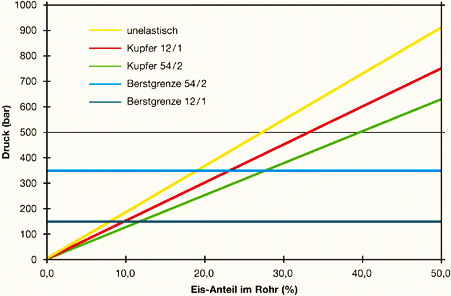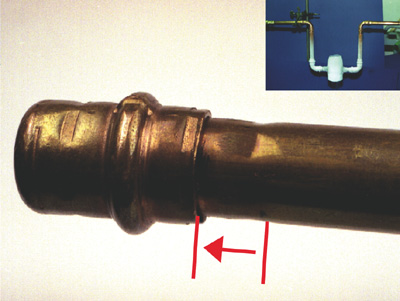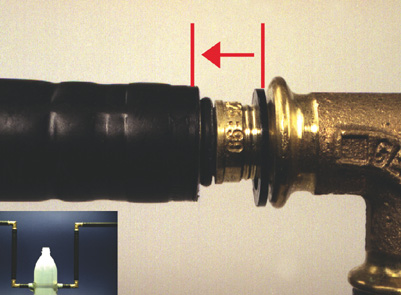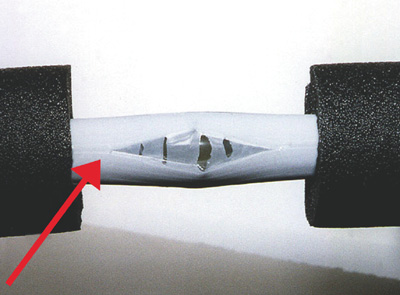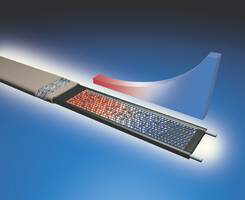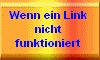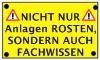Um das Einfrieren von Flüssigkeiten in der Haustechnik (Heizung, Trinkwasser, Abwasser, Erdkollektoren, Solaranlagen) zu verhindern, müssen verschiedene Frostschutzmaßnahmen und Frostschutzmethoden eingesetzt werden. Während der Dauerfrostperioden
mit Nachttemperaturen unter -15 °C und Tageshöchstwerte von -5 °C frieren immer wieder die Flüssigkeiten in den haustechnischen Anlagen ein.
Die VDI-Richtlinie 2069 "Einfrierschutz
von wasserführenden Leitungen" ist für
die Planung, den Bau, das Betreiben und das Instandhalten
von wasserführenden Systemen in frostgefährdeten
Bereichen anzuwenden.
Das Volumen von Eis ist größer als das flüssige Wasser, Das größere Volumen führt zu großen Kräften (Frostsprengung) und/oder sehr hohen Drücken in der Rohrleitung durch "Blitzeis".
Frostschutz-Strategien:
- Wärmezufuhr (z. B. durch elektrische Begleitheizung) der zu schützenden Bauteile, wenn die Umgebunstemperaturen unter +4 °C absinken.
- Dem Wasser wird Frostschutzmittel zugeführt, wodurch der Gefrierpunkt herabgesetzt wird.
- Der Wasserdurchfluss in Rohrleitungen darf nicht zum Stillstand kommen.
![]() In diesem Zusammenhang sollte immer bedacht werden, dass eine Wärmedämmung kein Frostschutz ist, sondern nur ein Einfireren verzögert und andere Maßnahmen unterstützen kann.
In diesem Zusammenhang sollte immer bedacht werden, dass eine Wärmedämmung kein Frostschutz ist, sondern nur ein Einfireren verzögert und andere Maßnahmen unterstützen kann.
Frostschutzmaßnahmen in nicht ständig oder selten genutze Gebäude
Immer wieder
stellt sich die Frage, welche Maßnahmen getroffen werden müssen,
um ein Einfrieren wassergefüllter Bauteile (Wasserleitungen,
Geruchsverschlüsse [Siphone], WC-Schüssel, aber auch oberirdische
Regenzisternen, Regentonnen, Gartenschläuche, Hochdruckreiniger und
Teichpumpen) in nicht ständig oder selten
genutze Gebäuden (leerstehende Wohnhäuser, Ferienhäuser)
zu verhindern. Wenn das Gebäude nicht genutzt wird und eine
Heizung nicht in Betrieb gesetzt werden soll, dann ist die sicherste
Möglichkeit das Wasser aus allen
wasserführenden bzw. wassergefüllten Bauteilen
(Heizung, allen Wasserleitungen, den Geräten (WW-Speicher), Spülkästen,
WC-Schalen und Geruchsverschlüsse [Sifone]) zu entleeren.
Wenn eine Entleerung der Rohrleitungen nicht
vollständig möglich ist oder nicht gewünscht wird, dann müssen die gefährdeten Bereiche oder Räume
frostfrei erwärmt werden, weil z. B. Trinkwasserleitungen nicht mit Froschutzmittel
befüllt werden können oder Heizungsleitungen nicht mit Frostschutzmittel gefüllt werden sollten.
Hierbei müssen einige
Dinge beachtet werden.
- Wasserheizungsanlagen wird man nie vollständig
entleeren und auch nicht mit Druckluft ausblasen können. Deshalb
kann es sinnvoll sein, die Anlagen mit einem Wasser-Frostschutzmittel-Gemisch
zu füllen, das regelmäßig überprüft werden muss.
- Wenn die Trinkwasserleitungen mit Gefälle verlegt
sind, kann das Wasser an der tiefsten Stelle abgelassen werden. Wobei
die Leitungen an der obersten Stelle belüftet werden müssen.
Sicherer ist es, die Leitungen mit Druckluft auszublasen. In Trinkwasserleitungen
aus Metall bestehen hier korrosive und hygienische Probleme. Solche Anlagen
müssen bei der Wiederinbetriebnahme gespült und beprobt werden.
- Bei elektrischen Trinkwassererwärmern
muss vor der Entleerung die Stromversorgung unterbrochen werden, damit
der Heizstab nicht durchbrennt.
- Bodenabläufe, WC-Schalen und
Urinale können mit einem Lappen ausgetrocknet
werden. Besser ist eine Zugabe von Frostschutzmittel oder Salz in das
Wasser. Wobei eine Salzzugabe sehr unsicher ist.
- Geruchsverschlüsse an Waschbecken,
Dusch- und Badewannen kann die Wasservorlage am Bauteil
entleert werden. Aber auch hier sind die Maßnahmen, die bei
den WC-Schalen angewendet werden, vorzuziehen. Natürlich dürfen
diese gefüllten Geruchsverschlüsse nicht gespült werden.
- Entleerte Geruchsverschlüsse lassen
die Gase aus dem Abwasserssystem in das Gebäude, was zu erheblichen
Geruchsproblemen führen kann. Besonders in eingerichteten Gebäuden
sollte man diese Methode nicht anwenden, da die Gerüche sich in der
Einrchtung festsetzen können. Über das Eindringen von Ungeziefer
wird auch berichtet. Für diese Zwecke werden inzwischen
Trockensifone angeboten, die aber meistens nur für Brennwertgeräte, Erdwärmetauscher
oder an Kühlregister von Klimaanlagen geeignet sind.
Wird ein Gebäude immer wieder regelmäßig genutzt (z. B. Wochenendhaus), dann sollte die Heizung auf "Frostschutz" betrieben werden. Dabei muss bei der Temperaturwahl darauf geachtet werden, dass die Räume über Raumthermostate geregelt werden, da z. B. in einem nach Süden ausgerichtetem Raum mit Raumthermostat (Referenzraum) zur Regelung des ganzen Hauses eingesetzt wird, noch Plusgrade sein können, während Räume, die nach Norden ausgerichtet sind, bereits Minusgrade auftreten können. Hier sollte die Systemtemperatur so niedrig wie möglich eingestellt werden und die Umwälzpumpe darf nicht automatisch abgeschaltet werden. Außerdem sollte man überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, die Anlage mit einen Wasser-Frostschutzmittel-Gemisch zu füllen, wenn das Haus nichtg regelmäßig überwacht wird, da dann bei einem unbemerkten Heizungsausfall die Probleme wie in einem nicht beheizten Gebäude auftreten können. Eine Fachfirma, die diese Anlage einstellt, sollte sich einen sog. " Frostbrief" unterschreiben lassen.
Das Einfrieren ist ein langsamer
Prozess, der zur Bildung eines Eispfropfens führt. Erst wenn dadurch keine Fließbewegung
mehr möglich ist, friert die Leitung auf der gesamten
Länge ein. Besonders kritisch ist das Einfrieren von
Leitungen von zwei Seiten oder in abgesperrten Leitunggsabschnitten.
Hier entstehen hohe Drücke im noch flüssigem Medium,
die weit über den zulässigen Nenndrücken
der Anlagenteile liegen, und zum Platzen der Rohre und besonders
von Verbindungsstellen führen können. Jedes Einfrieren
setzt aber eine längere Stagnation des Wassers voraus.
Wenn wasserführende Leitungen durch
außenluftbelüfteten Abseiten hinter den
Kniestöcken verlegt werden, so sind diese
Leitungen besonders gefährdet. Fehlerhafte Rohrdämmung
führt zu dem Einfrieren von 2 Seiten.
Aber Leitungen, die gleichmäßig einfrieren, sind
in vielen Fällen nach der Frostperiode noch
unbeschädigt.
|
|
Wenn Wasser zu Eis gefriert, dann dehnt es sich aus und vergrößert sein Volumen. Gleichzeitig nimmt seine Dichte ab. Deswegen ist Eis bei gleichem Volumen leichter als Wasser. Eis ist neben dem flüssigen und gasförmigen der 3. Aggregatzustand von Wasser und bildet sich bei Normaldruck, Anwesenheit von Kristallisationskeimen und einer Temperatur niedriger als 0 °C (Schmelz- bzw. Gefrierpunkt).
Reines Wasser gefriert erst bei -46 °C. Durch eine Erschütterung und/oder Verschmutzung friert das unterkühlte Wasser schlagartig ein.
|
|||
Flüssiges Wasser bei minus 46 Grad |
|||
Es kann vorkommen, dass Leitungen zufrieren, wenn schlecht oder nichtgedämmte Leitungsteile schon in den Minusbereich (< 0 °C) abgekühlt sind, aber auf Grund der Fließgeschwindigkeit das vorbeifließende Wasser noch nicht gefroren ist. Durch das Abschalten oder dem Ausfall der Pumpe kommt das Wasser zum Stillstand. Durch die plötzliche Eisbildung entstehen sehr hohe Drücke in der Rohrleitung. Hier wirkt das Rohr evtl. wie eine Einfriermanschette. Druckzunahme in
einer abgesperrten wassergefüllten Leitung bei "Umwandlung"
von Wasser in Eis. |
Druckzunahme in Wasserleitung durch Eisbildung |
Hier ein ausführlicher Bericht > Frosteinwirkung auf wasserführende Leitungssysteme
In der Gebäudetechnik ist der Einsatz. von selbstregulierenden Heizleitungen (Heizbänder) in vielen Fällen sinnvoll. Sie werden am häufigsten eingesetzt, um Frostschäden zu vermeiden.
Einsatz in der Gebäudetechnik:
- Kaltwasserleitungen
- Warmwasserleitungen
- Feuerlöschleitungen
- Wasserleitungen im Freigelände
- Öl- und Fettleitungen
- Tankanlagen
- Solaranlagen
- Dachrinnen, Scheddachrinnen
- Regenfallleitungen
- Dachflächen
- Schneefanggitter
- Stallungen und Tränken
Die industrielle Anwendungen für die elektrische Begleitheizungen sind sehr umfangreich. Hier sind es besonders die Rohrleitungen, in denen die gepumpten Flüssigkeiten die nicht auskondensieren oder aushärten dürfen. Aber auch Transportbehälter, Analyseschläuche, Pumpen, Ventile und Vakuumkammern benötigen elektrische Begleitheizungen.
|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
||||||
Hier ein ausführlicher Bericht > Frosteinwirkung auf wasserführende Leitungssysteme
Alle wasserfürhrenden Anlagen, die mit der Außenluft in
Berührung kommen, müssen vor dem Einfrieren geschützt werden. Hier werden Frostschutzmittel eingesetzt. Für jede
Anlagenart (Heizungsanlagen, Kühlanlagen, Solaranlagen) gibt es passende Mittel.
So gibt es z. B. spezielle Frostschutzmittel für den Einsatz in Solarkollektoren
als Wärmeübertragungsmedium (Solarflüssigkeit). Diese ist eine physiologisch unbedenkliche, eingefärbte,
klare Flüssigkeit auf Basis einer wässerigen Lösung von
1,2-Propylenglykol und höheren Glykolen, die als Wärmeträger in Solaranlagen, speziell bei höherer
thermischer Belastung, Verwendung findet. Das Produkt soll mit entionisiertem (vollentsalztem) Wasser (VE-Wasser) auf eine Frostsicherheit
von ca. -27 °C eingestellt. Die Anforderungen der DIN 4757, Teil 3, für solarthermische Anlagen werden dann erfüllt.
Sie sind gesundheitsunschädlich und haben eine doppelte Aufgabe zu erfüllen: Bei tiefen Temperaturen im Winter muß
die Sole flüssig bleiben und gleichzeitig die Metalle der Solaranlage vor Korrosion schützen.
Auch darf sich das Fluid nicht entmischen, damit die Frostsicherheit bestehen bleibt.
Auch im Primärkreis von Sole/Wasser-Wärmepumpen werden Frostschutzmittel auf
Glykol-Basis eingesetzt. Diese müssen einen Frostschutz bis mindestens -15 °C sicherstellen und geeignete
Inhibitoren für den Korrosionsschutz beinhalten. Fertiggemische gewährleisten eine
gleichmäßige Verteilung der Konzentration. Hier wird z. B. Wärmeträgermedium
"Tyfocor" auf Basis von Ethylenglycol
(Fertiggemisch bis -15 °C, grün) empfohlen. Wichtig ist eine genaue Dosierung, da besonders dieses Sole/Wasser-Gemisch
zu einem Wachstum von Mikroorganismen (Biofouling) führen kann.
Da Wasser-Frostschutzmittel eine höhere Viskosität und Dichte
besitzen, muß mit einem höheren Druckabfall beim Durchströmen der Anlage gerechnet werden. Zum Berechnen der Zuschläge gibt es
Diagramme für die Wärmeübergangszahl und den relativen Druckverlust – im Vergleich mit reinem Wasser. Diese Kurven sowie
weitere physikalische Daten befinden sich in den technischen Unterlagen der Hersteller. Außerdem hat ein Wasser-Glykol-Gemisch einen höheren
Ausdehnungskoeffizient.
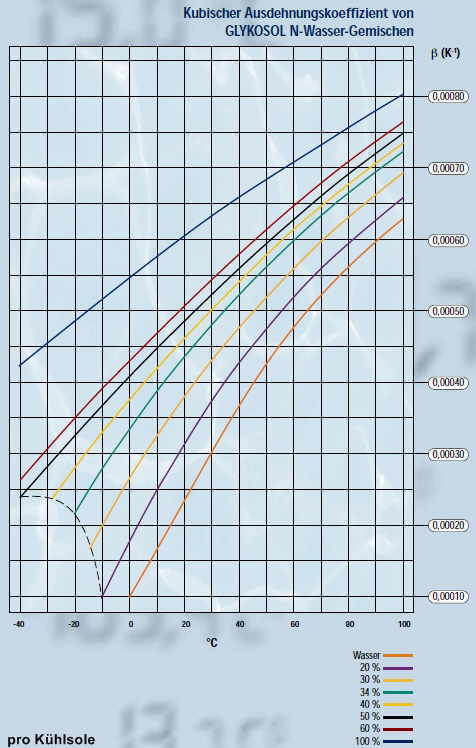
Kubischer Ausdehnungskoeffizient von GLYKOSOL N-Wasser-Gemischen
und Pekasol L-Wasser-Gemische
Quelle: pro Kühlsole
Frostschutzmittel
enthalten Korrosionsinhibitoren, die die Metalle der
Anlage, auch bei Mischinstallation, vor Korrosion dauerhaft schützen
Zur Prüfung der Wirksamkeit der Inhibitorenkombination sollte die
in Fachkreisen bekannte Korrosionsprüfmethode ASTM D 1384 (American
Society for Testing and Materials) zur Anwendung kommen. Glykol-Wassergemische
ohne Zusatz von Inhibitoren können wegen der korrosionsfördernden
Eigenschaften, die stärker als bei Wasser allein sind, nicht verwendet
werden.
Je nach Inhibitorzusammensetzung
werden diese vollständig, teilweise oder gar nicht vom
Medium wieder aufgenommen (Wasser und Propylenglykol sind verdampfbar;
die Inhibitoren kristallisieren auf den Absorberrohroberflächen).
Somit führen sie zu einer verminderten Kollektorleistung.
Die Inhibitorkonzentration im Medium bzw. der Korrosionsschutz
verringern sich. Deshalb wurden Wärmeträger, die auf
flüssigen Inhibitoren basieren, auf den Markt gebracht
(Tyfocor LS, Antifrogen SOL). Aus chemischer Sicht wird das
Propylenglykol durch oxidative Prozesse abgebaut, wobei
Reaktionsprodukte wie Milchsäure,
Oxalsäure, Essigsäure und Ameisensäure
nachweisbar sind. Es entstehen auch Aldehyde und diese führen
zu einer Geruchsbildung.
Unterhalb einer vom Hersteller festgelegten Konzentration kann
es zu einem Wachstum von Mikroorganismen
(Biofouling) in der Sole kommen, welche zu organischen Ablagerungen führen können.
Die Frostsicherheit sollte auf einen Stockpunkt von -34 °C (entsprechender Eisflockenpunkt: -27 °C)
eingestellt werden. Wie Versuche ergaben, übt diese Einstellung unter mitteleuropäischen Winterbedingungen
keine Sprengwirkung auf metallische Anlagenbauteile aus, da sich beim
Abkühlen unterhalb des Kristallisationspunktes ein Eisbrei bildet.
Bei Wasserzusätzen verringert sich natürlich die Frostsicherheit.
|
|
|
Videos aus der SHK-Branche |
SHK-Lexikon |
Hinweis! Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen, dass von meiner Website aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung eines unnötigen Rechtsstreites, mich umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit zügig Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Das zeitaufwändigere Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung einer für den Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen. Die Kostennote einer anwaltlichen Abmah-nung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne der Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen.