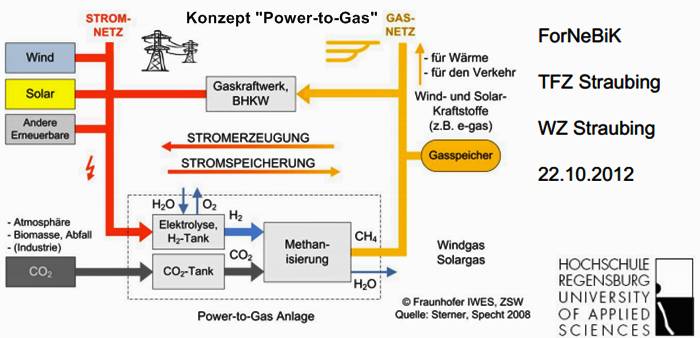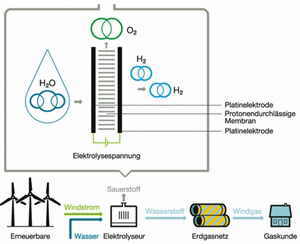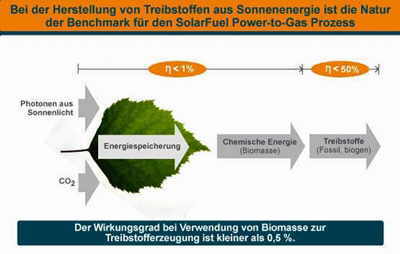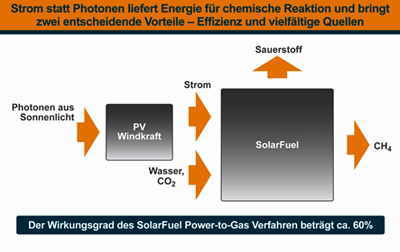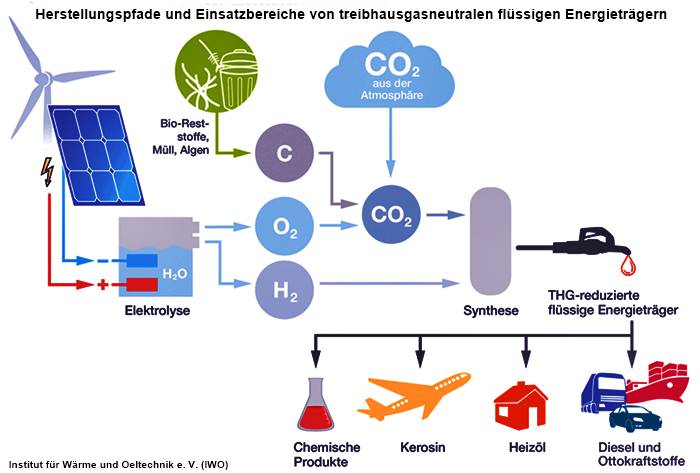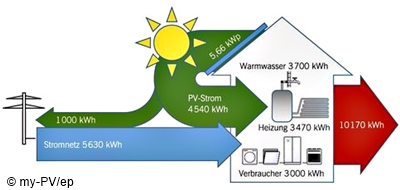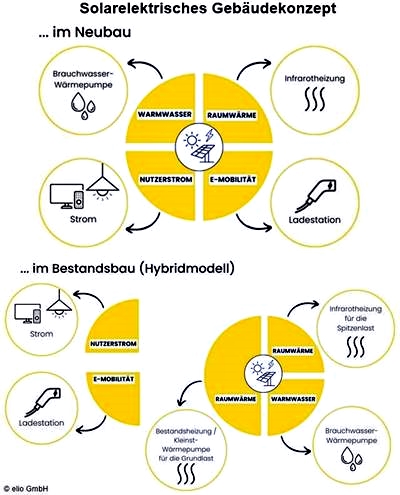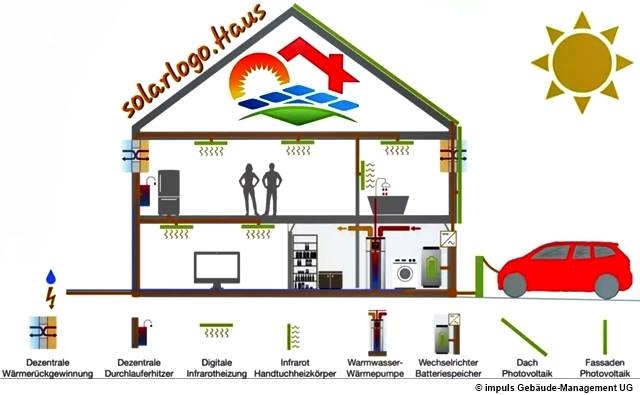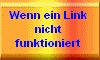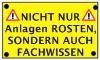Power to X (P2X bzw. P2Y1) ist der Sammelbegriff für verschiedene Technologien (Power to Heat, Power to Gas, Power to Liquid, Power to Chemicals), die sich mit der Speicherung oder Nutzung von Stromüberschüssen von erneuerbarer Energien (z. B. Windenergie, Photovoltaikanlagen, Wasserkraft, Geothermie) befassen. Hier ist eine Sektorenkopplung2 notwendig. Dadurch wachsen die Energieverbraucher und Energieerzeuger aus allen Sektoren zu einem ganzheitlichen System zusammen, das gemeinschaftlich Versorgungssicherheit effizient gewährleistet.
1
P Stromüberschüsse, die über dem Bedarf liegen und X bzw. Y Energieform oder Verwendungszweck, in den die elektrische Energie gewandelt wird.
2 Sektorenkopplung (Sektorkopplung, Sector Coupling, Integrated Energy) ist die Vernetzung der Sektoren der Energiewirtschaft und der Industrie, die in einem gemeinsamen holistischen Ansatz optimiert werden. Bisher wurden die Sektoren Elektrizität, Wärme- und Kälteversorgung, Verkehr und Industrie weitgehend unabhängig voneinander betrachtet. |
| P2X-Technologiepfade innerhalb der Sektorenkopplung |
Sektorenkopplungsart |
Technologiepfad |
verwendete Energiespeicher |
verwendete
Infrastruktur |
Strom - Wärme/Kälte |
Wärmepumpe*
Power to Heat
Kraft-Wärme-Kopplung
Power to Gas |
Wärmespeicher,
Kältespeicher |
Strom, Wärme, Gas
(Leitungsnetze) |
Strom - Gas |
Power to Gas |
Gasspeicher,
Gasleitungsnetz
|
Strom, Gas
(Leitungsnetze) |
Strom - Mobilität |
Power to Gas
Elektromobilität
Power to Liquid
|
Gasspeicher,
Gasleitungsnetz,
Batteriespeicher,
Kraftstoff- und
Brennstoffstank |
Strom, Gas
(Leitungsnetze)
Mineralöl, Wasserstoff
(Leitungsnetze, Tankstellen) |
Strom - Chemie |
Power to Chemicals
Power to Gas |
Rohstoffspeicher, Gasspeicher |
Strom, Gas
(Leitungsnetze),
Chemie |
| *Ob Elektrowärmepumpen zu Power-to-Heat
und damit zu Power-to-X gehören, wird kontrovers diskutiert. |
|
Power to X-Technologien – Türöffner für die Sektorenkopplung
Johanssen + Kretschmer - Strategische Kommunikation GmbH
Kopernikus-Projekt P2X
Bundesministerium für Bildung und Forschung - Referat 722: "Energie; Wasserstofftechnologien"
Bedeutung und Notwendigkeit von sektorenkoppelnden Speichern für die Energiewende
Prof. Dr.-Ing. Michael Sterner et al.
Forschungsstelle Energienetze und Energiespeicher FENES, OTH Regensburg
Funktionsweise von Windenergieanlagen
Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE)
Referat über Windkraftanlagen
Clemens Matuschek, uni-blog.info |
|
Power to Heat (PtH) |
 - -
|
Power to Heat ("Elektroenergie zu Wärme" - P2H oder PtH)
ist ein Bestandteil in der Energiewende. Hier wird elektrische Energie mit einem Wirkungsgrad von fast 100 % in Wärme umgewandelt (z. B. mit [Wärmepumpen*,] Elektrothermen, Elektrokessel, Elektrodenkessel, Blockheizkraftwerke [BHKW]) und eignet sich besonders gut, wenn erneuerbare Energie in ein Wärmenetz integriert werden soll. Dies ist dann sinnvoll, wenn überschüssiger Strom im Netz verfügbar ist. Dadurch kann das Stromnetz stabilisiert oder zur Erzeugung umweltschonender Gebäudewärme, Nahwärme oder Fernwärme genutzt werden.
* Ob Elektrowärmepumpen zu Power-to-Heat und damit zu Power-to-X gehören, wird kontrovers diskutiert.
Bei der Stromerzeugung (Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen) kann es je nach Wetterlage zu starken Schwankungen im Stromnetz kommen. Um diese Schwankungen auszugleichen, muss die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien geregelt oder sogar komplett vom Netz genommen werden. Aber auch die Verbraucher müssen in ihren Lasten flexibilisiert werden (Demand Response [Steuerung des Energieverbrauchs auf der Nachfrageseite, um Regelenergie zur Verfügung zu stellen und dadurch die Stromnetze zu stabilisieren]). Nur durch komplexe Steuerungsmechanismen kann eine konstante Frequenz von 50 Hertz eingehalten werden. Die Deutschen Netzbetreiber sind verpflichtet, die Netzfrequenz konstant auf 50 Hertz zu halten und Schwankungen durch den Stromüberschuss bzw. Strommangel auszugleichen.
In der Zukunft ist eine Elektroheizung in Verbindung mit der Photovoltaik wieder aktuell.
Das Motto lautet "Kabel statt Rohre".
Für ein Solarelektrisches Wohngebäude, das wärmetechnisch nach dem heutigen Stand der Technik neu errichtet oder fachgerecht thermisch saniert wird, ist ein wassergeführtes Heizsystem im Hinblick auf Leistung und Materialeinsatz bei der Installation nicht mehr notwendig. Die benötigte Heizlast pendelt sich zwischen 3 und 6 kW ein. Für diese geringe Leistung ist eine konventionelle Heizung völlig überdimensioniert. Der Grund liegt in der hydraulischen Wärmeverteilung. Diese ist aufwändig und verlustbehaftet. |
P2H Systeme
– Intelligente Umsetzung elektrischer Energie in Wärme
ELWA Elektro-Wärme GmbH & Co. KG
Stromüberschuss sinnvoll einsetzen
G+E GETEC Holding GmbH
E-Heat - Eigenen Solarstrom in der Heizung nutzen
Energie für Gebäude KG
Nachhaltigen Strom für Wärme nutzen
Vattenfall Europe Sales GmbH |
|
|
Power
to Gas (PtG) |
|
Power
to Gas Anlage |
Quelle:
Frauenhofer IWES, ZSW - Sterner, Specht |
|
Bei dem Konzept "Power
to Gas" (PtG oder P2G)
wird mit Hilfe von elektrischer Energie ein EE-Gas
(z. B. Wasserstoff1 oder Methan2) erzeugt, um die elektrischer Energie indirekt speichern zu können. Da die elektrische
Energie hauptsächlich durch Wind und Solar erzeugt wird, spricht
man hier auch von Windgas (Windstrom
zu Windgas) oder
Solargas (Methan
aus Sonne und Wind).
Der "überschüssiger"
Strom aus Windkraft-, PV-
oder Wasserkraft-Anlagen wird in Wasserstoff
oder synthetisches Erdgas umgewandelt und im Erdgasnetz
gespeichert. Die Umwandlung
von Strom in synthetisches Erdgas
erfolgt in zwei Schritten. Zuerst wird Wasserstoff
mittels Elektrolyse erzeugt, anschließend folgt
die Methanisierung (unter Verwendung von Kohlenstoffdioxid
[CO2] in synthetisches Methan).
1 Wasserstoff gilt als einer der Energieträger der Zukunft, da er im Gegensatz zu fossilen Stoffen bei Verbrennung keine schädlichen Emissionen verursacht und aus erneuerbaren Energien gewonnen werden kann. Wichtige Einsatzfelder sind:
- Wasserstoff findet zunehmend Einsatz als Kraftstoff in Wasserstoffverbrennungsmotoren oder in Brennstoffzellen. Aufgrund seiner umweltfreundlichen Eigenschaften wird Wasserstoff gegenüber fossilen Brennstoffen bevorzugt, dabei der Verbrennung lediglich Wasser und kein Kohlenstoffdioxid entsteht.
- Mit Wasserstoff lassen sich bei der Kohlehydrierung künstlich flüssige Kohlenwasserstoffe herstellen, die fossile Kraftstoffe ersetzen.
- Wasserstoff wird in der Industrie bei der Veredelung von Metallen, der Produktion von Düngemitteln oder als Kühlmittel verwendet.
Zudem dient Wasserstoff der Energiespeicherung. Hierbei wird je nach den spezifischen Eigenschaften unterschieden zwischen:
- gasförmig: Speicherung in Druckbehältern
- flüssig: Speicherung in vakuumisolierten Behältern
- Einlagerung in Metallhydriden oder in Kohlenstoff-Nanoröhren.
2Der regenerativ erzeugte Wasserstoff aus der Elektrolyse kann unter Nutzung von Kohlenstoffdioxid in einer nachgeschalteten Methanisierung in Methan überführt werden. Die Anwendungsfelder sind vielfältig:
- Substitut für fossile Gase bei der Wärmeerzeugung
- Verwendung als erneuerbarer Kraftstoff für Gasfahrzeuge
- Wichtiges Element zur Erzeugung von weiteren chemischen Verbindungen durch Synthese [z. B. Wasserstoff, Ethin oder Methylhalogenid) |

Methanisierung von überschüssigem Strom macht konventionelle Kraftwerke überflüssig
Quelle: MicrobEnergy GmbH / Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Power to Gas: Schlüsseltechnologie der Energiewende
DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. - Technisch-wissenschaftlicher Verein
Wie Power-to-Gas funktioniert
Agentur für Erneuerbare Energien e.V. (AEE)
Power-to-Gas
Vattenfall Europe Sales GmbH
Potenziale von Power-to-Gas Energiespeichern
Mareike Jentsch/Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES
Kraftwerke und Windleistung in Deutschland
Umweltbundesamt |
|
Power to Liquid (PtL) |
Bei Power to Liquid wird mit Hilfe von Strom zunächst durch die Wasserelektrolyse Wasserstoff erzeugt (Power to Gas). Der Wasserstoff kann anschließend mit Kohlenmonoxid oder Kohlendioxid in einer Synthese zu Kohlenwasserstoffen umgewandelt werden. Durch verschiedene Synthesen (z. B. Methanolsynthese, Fischer-Tropsch-Synthese [FTS]) können die Kohlenwasserstoffe nach Abscheidung des gebildeten Wassers durch Raffinerieprozesse zu Brenn- und Kraftstoffen (Synfuels) und Chemikalien weiterverarbeitet werden. |
Synthetische Kraft- und Brennstoffe - Synfuels |
Synthetische Kraft- und Brennstoffe (Synfuels) werden künstlich hergestellt. Durch das Aufspalten der Moleküle des Ausgangsmaterials (z. B. Pflanzen, Pflanzenöl, Wasser und Kohlendioxid [CO2]) entsteht synthetisches Gas.
Danach werden die Spaltprodukte dieses Gases neu sortiert und in einen flüssigen Rohstoff umgewandelt, der vor allem aus kettenförmigem Kohlenwasserstoff besteht. Aus diesem flüssigen Rohstoff können verschiedene Produkte (z. B. Diesel,
Heizöl, Kerosin) hergestellt werden.
Synfuels verbrennen deutlich sauberer als rohöl-basierte Kraft- oder Brennstoffe. Sie
erzeugen weniger Schadstoffe (z. B. Kohlendioxid [CO2], Stickoxide [NOX], Feinstaub) und schonen z. B. die Filter und Motoren der Kraftfahrzeuge.
Außerdem sind sie problemlos und lange lagerfähig und sind kälteunempfindlich. Außerdem können die Synfuels die Erweiterung und/oder neue Erstellung von Stromtrassen verhindern, die zunehmend von der Bevölkerung abgelehnt werden. |
- E-Fuels (PtL - Power to Liquid > Elektrische Energie zu Flüssigkeit)
- HVO (Hydrogenated oder Hydrotreated Vegetable Oils > hydrierte Pflanzenöle)
- GtL-Verfahren (Gas to Liquids > Gasverflüssigung)
- BtL-Verfahren (Biomass to Liquid > Biomasseverflüssigung)
- XtL-Kraftstoff
Status und perspektiven flüssiger Energieträger in der Energiewende - IWO |
|
Power to Chemicals (PtC) |
. |
. |

Power-to-liquids/chemicals
Mathias Kelter
Power-to-Chemicals (PtC)
C & CS catalysts and chemical specialties GmbH |
|
|
In der Zukunft
wird es immer dringender, Ökostromüberschüsse
aus Photovoltaik- und Windkraft-Anlagen
sinnvoll zu verwenden bzw. zu speichern. Der Ausbau
der Stromnetze wird immer mehr abgelehnt und Stromspeicher,
so z. B. Pumpspeicherkraftwerke
(Wasser oder Druckluft) werden immer mehr abgelehnt, Batterien können
nur kurzfristig speichern. Deshalb wird erneuerbarer Strom
in Wasserstoff und Methan (EE-Gas
- erneuerbares Gas) umgewandelt. Dieses Konzept wird
auch "Power to Gas" genannt. Das gesamte
deutsche Erdgasnetz steht mit sehr großen Speicherkapazitäten
zur Verfügung. Es kann als Speicher für Ökostrom
genutzt werden, denn es ist jetzt schon 45 mal so groß
ist wie die Gesamtkapazität aller heute in Deutschland
bestehenden Pumpspeicherkraftwerke. |
Zur Zeit liefert
Greenpeace Energy eG
Erdgas, dem nach und nach Wasserstoff
beigemengt wird, sobald dieser verfügbar ist. Aus technischen und
regulatorischen Gründen darf nur bis zu einer Obergrenze von 5
% Wasserstoff ins Gasnetz eingespeist werden.
Wasserstoff, der nicht eingespeist werden kann, wir
zu erdgasgleichem Methan umgewandelt. In der Zukunft
können erneuerbarer Wasserstoff und erneuerbares Methan das fossile
Erdgas zu 100 Prozent ersetzen. |
|
Windstrom
zu Windgas - Elektrolyseur |
Quelle:
Greenpeace Energy eG |
|
Grundlage für
die Umwandlung von Windstrom
in Windgas ist das Elektrolyse-Verfahren.
Hierbei wird der Strom, der z. B. nicht in das vorhandene
Stromnetz eingespeist werden kann, eingesetzt, um Wasser
in seine Grundstoffe (Wasserstoff und Sauerstoff) aufzuspalten.
Der Wasserstoff wird durch die Elektrolyse mit einem sehr
hohen Wirkungsgrad von bis zu 73 % hergestellt. |
Der freigesetzte Sauerstoff wird in
die Atmosphäre, der Wasserstoff ins Gasnetz eingespeist.
Durch ein weiteres chemisches
Verfahren lässt sich überschüssiger
Wasserstoff „methanisieren“.
Das erneuerbare Methan kann das herkömmliche Erdgas
langfristig vollständig ersetzen und damit den Übergang
von fossilem zu erneuerbarem Gas leisten.
|
| |
|
|
|
Methan
aus Sonne und Wind |
|
Wirkungsgrad
Photon-to-Biofuel in der Natur |
| Quelle:
SolarFuel GmbH
|
|
|
Wirkungsgrad
SolarFuel Power-to-Gas |
Quelle:
SolarFuel GmbH |
|
In der Zukunft
wird es immer dringender, Ökostromüberschüsse
aus Photovoltaik- und Windkraft-Anlagen
sinnvoll zu verwenden bzw. zu speichern. Der Ausbau
der Stromnetze wird immer mehr abgelehnt und Stromspeicher,
so z. B. Pumpspeicherkraftwerke
(Wasser oder Druckluft) werden immer mehr abgelehnt, Batterien können
nur kurzfristig speichern und Wasserstoff stellt sich auch als nicht
wirtschaftlich dar. Deshalb wird in einer Versuchsanlage
(ZSW, Fraunhofer IWES und SolarFuel) daran gearbeitet, erneuerbaren
Strom in Methan umzuwandeln. Das gesamte
deutsche Erdgasnetz steht mit sehr großern Speicherkapazitäten
zur Verfügung. |
Die SolarFuel-Technologie
wandelt die energielosen Rohstoffe CO2 und
Wasser mit Hilfe von elektrischem Strom in synthetisches
Erdgas um. Im ersten Schritt wird in der Elektrolyse
Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff
zerlegt. Im zweiten Schritt wird Wasserstoff mit CO2
zu Methan (CH4) umgesetzt. Die Energiedichte
steigt dabei um den Faktor 3 an und es entsteht ein marktfähiger
und handelbarer Energieträger in Normqualität,
der direkt in das Erdgasnetz eingespeist werden kann.
Der erzielbare Wirkungsgrad ist größer als 60 Prozent und
somit realisiert das SolarFuel Power-to-Gas Prozess
eine Energiespeicherung nahe am thermodynamischen Optimum. |
Das Gas kann in
Gaskraftwerken mit KWK-Technik rückverstromt,
mit Mini-BHKWs Wohnhäuser beheizen
oder als Autogas verwendet werden. |
|
|
Die Verbrennungsmotoren und die Öl- und Gasheizungsanlagen müssen nicht am Ende sein. Synthetische Kraft- und Brennstoffe (E-Fuels - [PtL - Power to Liquid >
Elektrische Energie zu Flüssigkeit]) können in der Zukunft eine Alternative zum Strom (z. B. Wärmepumpe, E-Heizung) und Wasserstofftechnik (Brennstoffzellen) sein. Bei der Herstellung von E-Fuels (z. B. Heizöl, Diesel, Benzin, Kerosin) wird so viel CO2 aus der
Atmosphäre bzw. der Biosphäre entnommen wie später bei der Verbrennung freigesetzt wird. Es sind daher CO2-neutrale Kraft- und Brennstoffe,
die aus regenerativ erzeugtem Strom (Photovoltaik, Windkraft, Wasserkraft) hergestellt werden.
Flüssige Brennstoffe bestehen in der Regel aus Kohlenstoff und Wasserstoff.
Bei ihrer Verbrennung entstehen hauptsächlich Wasser (H2O) und Kohlendioxid (CO2).
Wird dieses CO2 wieder in den Entstehungsprozess der Brennstoffe eingebunden, entsteht ein geschlossener Kohlenstoffkreislauf und ist
weitgehend Treibhausgasneutral. Kohlendioxid wird dadurch zum nachhaltigen Rohstoff, da dieselbe Menge bei der
Verbrennung freigesetzt wird, wie bei der Produktion der Atmosphäre entzogen wird.
Synfuels aus Pflanzenöl oder/und Fett (HVO [Hydrogenated oder
Hydrotreated Vegetable Oils > hydrierte Pflanzenöle]) wären aufgrund der benötigten großen
Anbauflächen nicht so sinnvoll.
Viele Länder wollen ab 2030 die Verbrennungsmotoren für Neuwagen verbieten.
Hier könnten z. B. E-Fuels für die in Deutschland im Bestand (2017) befindlichen ca. 57 Millionen Kraftfahrzeuge, 13,3 Millionen Gasheizungen, 5,6 Millionen Ölheizungen, 0,7 Millionen Gas-Raumheizer und 1,1 Millionen Gas-Warmwasserbereiter aber auch in Flugzeugen, Schiffen und in der Industrie (chemische Produkte) eine mögliche Alternative sein. Dieses Thema wird kontrovers diskutiert.
Im Gegensatz zum Strom sind flüssige Energieträger gut speicherbar und leicht zu transportieren. Außerdem haben sie eine hohe Energiedichte und verfügen über eine
hervorragende vorhandene Infrastruktur. Um diese Vorteile auch langfristig in der Energieversorgung nutzen zu können, wird an der Herstellung treibhausgasreduzierter flüssiger Kraft- und Brennstoffe intensiv geforscht.
Ein wichtiger Aspekt ist, dass sie in heute verfügbarer Technik ohne aufwändige Umrüstungen einsetzbar sein sollen. Außerdem können die E-Fuels die Erweiterung und/oder neue Erstellung von Stromtrassen verhindern, die zunehmend von der Bevölkerung abgelehnt werden. |
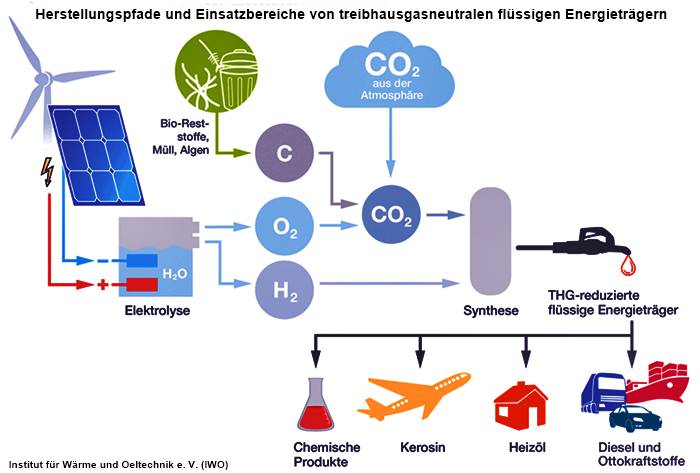
Herstellungspfade und Einsatzbereiche von treibhausgasneutralen flüssigen Energieträgern
Quelle: Institut für Wärme und Oeltechnik e. V. (IWO)
Norweger bauen gigantische Fabrik für Wunder-Diesel - manager magazin new media GmbH
Hoffnungsträger für ein Auslaufmodell - cst/Annika Grah, dpa
Brennstoffe der Zukunft - Brennstoffforschung - Institut für Wärme und Oeltechnik e. V. (IWO)
Dieses Thema wird kontrovers diskutiert
Sind E-Fuels die Lösung? -
Christiane Köllner
Benzin und Diesel vor unsicherer Zukunft: Das E-Fuel-Märchen
Ist die Brennstoffzelle die Zukunft? Die Alternative zum E-Auto |
|
| Solarelektrisches Wohngebäude |
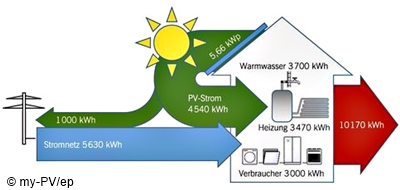 . .
Energieflüsse und Jahresenergiebilanz mit photovoltaischer Wärmeerzeugung
Heizung mit Photovoltaik
my-PV GmbH
Das solarelektrische Wohngebäude
R. Hofstätter, HUSS-MEDIEN GmbH
Gebäudeversorgung solarelektrisch
R. Hofstätter, Bauverlag BV GmbH
Was ist ein solarelektrisches Haus?
ETHERMA - Deutschland GmbH
Kabel statt Rohre – Potenziale solarelektrischer Haustechnik
Michael Wanner, elektro.net - Hüthig GmbH
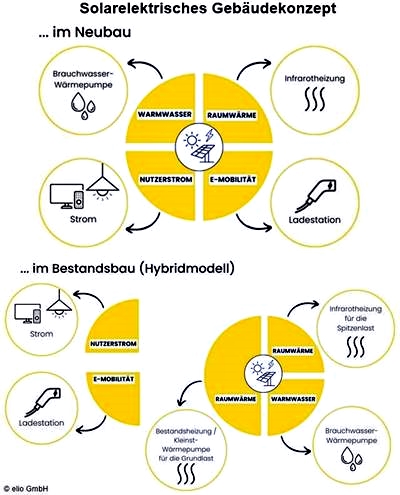
Energiekonzept
Solarelektrisches Gebäudekonzept
Dirk Bornhorst, elio GmbH
|
In der Zukunft ist eine Elektroheizung in Verbindung mit der Photovoltaik wieder aktuell.
Das Motto lautet "Kabel statt Rohre".
Für ein Solarelektrisches Wohngebäude, das wärmetechnisch nach dem heutigen Stand der Technik neu errichtet oder fachgerecht thermisch saniert wird, ist ein wassergeführtes Heizsystem im Hinblick auf Leistung und Materialeinsatz bei der Installation nicht mehr notwendig. Die benötigte Heizlast pendelt sich zwischen 3 und 6 kW ein. Für diese geringe Leistung ist eine konventionelle Heizung völlig überdimensioniert. Der Grund liegt in der hydraulischen Wärmeverteilung. Diese ist aufwändig und verlustbehaftet.
Elektrische Heizungen erzeugen die Wärme direkt am Ort des Bedarfs.
Für Gebäude mit einem spezifischen Heizwärmebedarf von 40 kWh pro m2a (Niedrigenergiehaus bzw. KfW-Effizienzhaus 40 Plus, 40 oder 55) oder weniger (Passivhaus) gibt es also mittlerweile bessere und vor allem einfachere Möglichkeiten. Dabei investiert man nicht eine große Summe für die Haustechnik im Keller, sondern nimmt stattdessen einen Teil des Budgets, um seine verfügbare Dachfläche möglichst vollständig mit Photovoltaikmodulen zu belegen.
Ein solarelektrisches Gebäude benötigt thermische Speichermasse, um den Tagesgang der Sonnenenergie optimal nutzen zu können.
Thermische Bauteilaktivierung bzw. Betonkernaktivierung sind etablierte Begriffe, die das Konzept einer Fundamentplatte als Wärmespeicher beschreiben. Der Beton wird somit zum Tagspeicher für PV-Überschuss. Ergänzend wird die Netzeinspeisung wesentlich vermindert. Die riesige Masse des Betons stellt dabei ein geeignetes und kostengünstiges Speichermedium für Wärme dar und ermöglicht auch bei ganzjähriger Betrachtung hohe Autarkiegrade. Um ungewollte Wärmeverluste in Richtung Erdreich zu begrenzen, wird unterhalb der Fundamentplatte eine Dämmschicht angelegt. |
|
Zusätzlich sind elektrische Heizmatten in Fußboden, Wand oder Decke notwendig. Diese sind jedoch deutlich preisgünstiger als eine wassergeführte Fußbodenheizung und obendrein können die meisten dieser Produkte auch auf bestehenden Estrichen verlegt werden. Für Sanierungen bedeutet dies den überragenden Vorteil, dass nur der Bodenbelag neu gemacht wird und nicht der gesamte Aufbau abgerissen und ersetzt werden muss.
Wie bei wassergeführten Fußbodenheizungen bieten aber E-Heizmatten den Vorteil, dass die Masse des Bodens, Wände und Decken thermisch aktiviert werden kann. Dieser kann somit als Tagspeicher für photovoltaische Überschüsse verwendet werden, Erzeugungsschwankungen werden gut ausgeglichen.
Heizen mit Photovoltaik bedeutet um 30 % geringere Betriebskosten und um bis zu 30 % geringere Investitionskosten im Vergleich zu konventionellen Heizungssystemen (z. B. Luftwärmepumpen). Die Wartungskosten liegen bei null. Die Energie wird selbst erzeugt, verbrauchen sie effizient und sinnvoll direkt vor Ort und können sie speichern.
Heizen mit Photovoltaik .....
• spart Energiekosten durch geringeren Bedarf aus dem konventionellen und immer teurer werdenden Stromnetz.
• verbessert die Klimabilanz durch selbst erzeugten Solarstrom.
• sorgt für eine optimale Nutzung und Speicherung von Solarenergie.
• spart fossile Brennstoffe wie Gas und Öl.
• reduziert durch höheren Eigenverbrauch das unwirtschaftliche Einspeisen des Überschusses ins Stromnetz.
• verzichtet auf zusätzliche Rohrleitungen, Pumpen, usw.
• ist geräuschlos.
• ist platzsparend – kein Heiz- und Brennstofflagerraum notwendig.
• ist auch für Sanierungen einfach verwendbar (z. B. keine Stemmarbeiten beim Estrich notwendig).
• ist selbstverständlich auch in wassergeführten Heizungssystemen möglich.
• schont Ihre bestehende Heizung und verlängert ihre Lebensdauer.
• erzeugt Wärme dort, wo sie gebraucht wird. |
Der Einsatz solcher Systeme erfordert aber ein Umdenken,
was vielen Planern und Bauherren schwer fällt. |
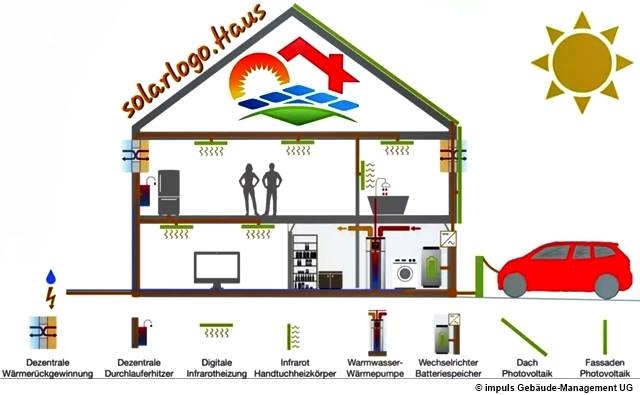 . .
Weniger ist mehr
Das solarelektrische solarlogo.Haus™
Intelligent und Konsequent schlanke Gebäudetechnik
impuls Gebäude-Management UG
|
|
EBITSCH Innovation 2MAX Wärmespeicher
Bei diesem System ist eine direkte Koppelung mit der PV-Anlage möglich, modulierender Betrieb von 600 Watt bis zur maximalen Lleistung. Kein Stromverbrauch aus dem Netz. Der 2Max-PV-Converter erzeugt aus 1 kW Solarstrom bis 5 kW Wärme. |
 . .
.
EBITSCH Innovation 2MAX Wärmespeicher
EBITSCHenergietechnik GmbH
|
Die Nutzung der Energie von PV-Modulen für die Heizung hat eine ganze Reihe von Vorteilen. Während Solarthermiekollektoren wegen der
Stillstandszeiten im Hochsommer aufgrund fehlenden Bedarfs und
im Winter mangels direkter Sonneneinstrahlung praktisch nur ein
halbes Jahr effizient arbeiten, liefert die PV-Anlage permanent
Strom - sogar im Winter bei diffuser Sonneneinstrahlung. In Verbindung
mit dem Ebitsch Photothermie-Converter lässt sich bei solchen
Wetterverhältnissen mehr Wärme erzeugen als mit Solarthermie-Kollektoren.
Ist der Saisonspeicher beladen, kann der überschüssige
Strom im Eigenverbrauch genutzt oder ins Netz eingespeist werden.
Die überschüssige Wärme von Solarthermie-Kollektoren
geht dagegen nicht nur ungenutzt verloren, sondern führt
zudem noch zu stärkeren Materialbelastungen aufgrund von
Dampfbildung und Überhitzung der Solarflüssigkeit (Stagnationsproblem).
Während Solarkollektoren meist mit 5 bis 10 Jahren Garantie
ausgeliefert werden, sind die langen Garantiezeiten von 25 Jahren
für PV-Module ein weiteres Argument für das Ebitsch
Photothermie-System. |
|
|
|