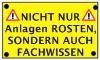| |
In einer Photovoltaikanlage wird die Sonnenenergie durch den photoelektrischen Effekt (Gleichstrom) in Solarzellen (Photovoltaik-Module) mit Hilfe eines Wechselrichters in nutzbaren Strom (Wechselstrom) umgewandelt. Durch die staatlich Förderung in Form einer garantierten Einspeisevergütung (Einspeisung ins Stromnetz [On-Grid-System]) und der Möglichkeit zum Eigenverbrauch des erzeugten Solarstroms (z. B. mit einer Wärmepumpe) hat die Investition in Photovoltaikanlagen einen Hype ausgelöst. Diese Anlagen sind nicht nur nachhaltig, sondern in den meisten Fällen auch wirtschaftlich. Auf welchem Niveau sich diese Anlagen im Markt einpegeln, muss abgewartet werden.
Dringend ist ein Ende der Regulierungswut sowie ein Aussetzen zeitraubender Genehmigungsverfahren notwendig.
Die Bundesregierung hat eine PV-Strategie erarbeitet und Maßnahmen festgelegt, damit mehr PV-Anlagen auf Hausdächern und Freiflächen installiert werden. Auch die Bundesländer fördern vor allen Dingen die Mini-PV-Anlagen bzw. Balkonkraftwerke. Funktionieren kann das nur gemeinsam mit den Elektrikern und Dachdeckern, denn diese sind vorrangig mit dem Planen und Installieren auf die Dächer zuständig. Um den Solarausbau noch weiter voranzutreiben, müssen unter anderem die Genehmigungsverfahren für Freiflächenanlagen beschleunigt werden. Auch mehr Gewerbeflächen müssen für PV-Anlagen genutzt und steuerliche Hürden abgebaut werden.
Neue Pflichten für PV-Anlagenbetreiber ab 2025: Ist deine Anlage bereit für ZEREZ?
Louisa Knoll, metergrid GmbH
Photovoltaik mit Batteriespeicher günstiger als konventionelle Kraftwerke
Dr. Christoph Kost, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE
Photovoltaik-Strategie
Handlungsfelder und Maßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der Photovoltaik
(Stand 05.05.2023)
Das Solarpaket I im Überblick (26. April 2024 im Bundestag verabschiedet)
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)
Bundestag stimmt Solarpaket zu - darum geht's
ZDF
Balkonkraftwerk neues Gesetz 2024 – Alle wichtigen Infos
AceFlex GmbH
Die 10 Dinge, die Sie vor Ihrer PV Investition wissen sollen
D,5 Energie GmbH
PV-Anlage kaufen: Die sechs besten Tipps
Dr. Gudrun Valerius, solaranlage-ratgeber.de - Anondi GmbH
Solarteur - Solar-Installateur - Solarmonteur - PV-Monteur
Damit der Solarausbau, wie es in der PV-Strategie der Bundesregierung erarbeitet und Maßnahmen festgelegt wurden. Um mehr PV-Anlagen auf Hausdächern und Freiflächen zu installiert, müssen sich die Strukturen am Markt ändern. Es kann nur durch die gewerkübergreifende Zusammenarbeit von Elektriker und Dachdecker funktionieren. Wobei hier, wie zur Zeit in allen Gewerken, ein Fachkräftemangel besteht. Außerdem müssen eine wirksame Verzahnung von Energie- und Steuerrecht sowie Lieferketten gesichert und wettbewerbsfähige, europäische Produktion angereizt werden.
Nur ein Elektroinstallateur mit einer erfolgreich abgeschlossenen, anerkannten Zusatzqualifikation zur Installation, Inbetriebnahme und Wartung von PV-Anlagen darf sich Solarteur nennen (das ist aber strittig). Der Solarteur ist kein gesetzlich geregelter Ausbildungsberuf. Über Ausbildungs- bzw. Fortbildungslehrgänge zur "Fachkraft für Solartechnik" kann man eine Qualifikation erwerben. Eine Alternative bietet die Ausbildung zur "Fachkraft für umweltschonende Energietechniken", die auch die Ausbildung zum PV-Monteur beinhaltet.
Neben der HWK, IHK, TÜV und Dekra bieten auch viele Fortbildungseinrichtungen und große PV-Hersteller Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Qualifizierungslehrgänge an. Die verschiedenen Lehrgänge unterscheiden sich im Umfang von dem zu erreichten Ziel. Zum einen werden Fachkräfte für die Beratung, Planung und Anschluss der Anlagen an das Stromnetz ausgebildet und auf der anderen Seite werden Fachkräfte für die Montage der Module geschult.
So ist z. B. der Lehrgang einer HWK für Gesell*innen und Fachkräfte der SHK-, Metall- und Elektro-, Bau- und Ausbauberufe mit Berufsabschluss sowie Interessenten, die Kenntnisse nachweisen können, die eine Zulassung zur Fortbildungsprüfung rechtfertigen, konzipiert.
Der Lehrgang für das theoretische und praktische Wissen rund um die Planung und Installation von Solaranlagen (Photovoltaik und Solarthermie) findet berufsbegleitend (Freitagnachmittag und Samstag) statt und bereitet die Teilnehmer*innen auf die gewerkübergreifende Fortbildungsprüfung "Fachkraft für Solartechnik (HWK)" vor.
Lehrgangsinhalte:
Grundlagen der Solarenergie
• Rechtliche Rahmenbedingungen, Förderungen, Unfallverhütung und Arbeitsschutz
Solarthermie
• Komponenten solarthermischer Anlagen
• Systeme zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung
• Montage, Wartung und Service
Photovoltaik
• Grundlagen, Systeme und Anwendungen
• Bestandteile von PV-Anlagen
• Wärmepumpe
• Planung von netzgekoppelten und Insel-Anlagen
• Installation, Wartung und Service
Hybride Anlagen
• Photovoltaisch-thermische Kollektoren
Kundenberatung
• Technische Vorgänge kundengerecht erklären
Hinweis:
Das Anschließen von PV-Anlagen an das öffentliche Stromnetz darf ausschließlich durch konzessionierte Elektrofachkräfte vorgenommen werden. Diese Zulassung kann nur durch den jeweiligen regionalen Netzbetreiber erfolgen und ist nicht Teil dieser Weiterbildung. Ausgenommen von dieser Regelung ist die Inbetriebnahme von autark arbeitenden PV-Insel-Anlagen.
Aus den Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfond der Europäischen Union wurde ein eLearning-Angebot (Online-Kurse) gefördert.
1 - Grundlagen
* PV-Anlagensysteme
* PV-Anwendungen
* Solarstrahlung
* photovoltaischer Effekt
* Funktion von Solarzellen
* Zellarten
* Eigenschaften von Solarzellen
2 - Bestandteile von PV-Anlagen
* PV-Module
* Generatoranschlusskasten, Strangsicherungen und Strangdioden
* Wechselrichter
* Kabel, Leitungen und Anschlusstechnik
* Gleichstromlastschalter (DC-Hauptschalter)
* AC-seitige Leitungs- und Fehlerstromschutzschalter
* Freischaltstelle und Netzintegration
* Zähleinrichtung
3 - Vororttermin, Standortaufnahme und Verschattungsanalyse
* Vororttermin und Standortaufnahme
* Kundengespräch und Beratung
* Verschattung
* Verschattungsanalyse
* Ertragsoptimierte Verschaltung
* Verschattung bei aufgeständerten Solaranlagen
* Checklisten zur Gebäudeaufnahme
4 - Montagesysteme und Gebäudeintegration
* Aufdachsysteme für schräge Dächer
* Indachsysteme für schräge Dächer
* Fassaden
* Glasdächer
* Montagesysteme
* Nachführsysteme
5 - Installation und Inbetriebnahme von PV-Anlagen
* Allgemeine Installationshinweise
* Sicherheitsbestimmungen
* Beispielinstallation PV-Anlage
* Einspeisevertrag
* Inbetriebnahme und Abnahme
* Fehler und Fehlersuche
* Betriebsüberwachung und -ergebnisse
* Qualität von PV-Anlagen
* Steuer- und Versicherungsfragen
6 - Markt, Wirtschaftlichkeit und Ökologie
* Der Markt
* Kosten und Preisentwicklung
* Technische Tendenzen
* Potential für PV Anlagen in Deutschland
* Finanzierung
* Betriebswirtschaftliche Bewertung
* Energiebilanz
* Elektrosmog
Quelle: IZT
Berufliche Weiterbildung Photovoltaik
IZT – Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung gemeinnützige GmbH
Der Solarteur: Experte für Solaranlagen
Solarwatt GmbH
Ausbildung zum Solarmonteur: So läuft die Fortbildung bei Enpal ab
Theresa Paape, Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH
Neue Schulung für PV-Montage
Hüthig GmbH
So denken Elektriker und Dachdecker über die Solar-Offensive
Jana Tashina Wörrle, DHZ
PV-Anlagen installieren: Nah an der Sonne, nah am Abgrund
Barbara Oberst, DHZ - Holzmann Medien GmbH & Co. KG
Photovoltaik-Anlage & Steuern - Das sind die neuen Steuerregeln
Anna Maringer, WISO Steuern - Buhl Data Service GmbH
Photovoltaikanlage installieren
Eine Firma zu beauftragen, um eine PV-Anlage zu installatieren, ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Die PV-Module können selbst montiert werden, aber die gesamte Anlage muss von einem Elektroinstallateur angeschlossen werden. Im gesamten Montageprozess gibt es einiges zu beachten, vor allem die Brandschutzsicherheit. Bei Photovoltaikanlagen fließen erhebliche Gleichströme, die weit über die haushaltsüblichen 220 Volt-Leitungen hinausgehen. Somit steigt die Brandgefahr durch Lichtbögen, wenn die Verkabelung unsachgemäß oder schlecht isoliert installiert wird, denn die Leitungen verlaufen durch das Haus. Fehler bei der Montage oder Installation können schwerwiegende Konsequenzen haben, bei einer unsachgemäßen Installation erlischt die Garantie auf die PV-Module oder der Versicherungsschutz der Anlage im Schadensfall. Deswegen wird von einer eigenhändigen Montage einer Photovoltaikanlage abgeraten. Zum Schutz der persönlichen und finanziellen Sicherheit sollte die Anlage von einem Fachbetrieb (Solarteur) installiert werden.
Steckerfertige Balkon-PV-Anlagen dürfen in Eigenleistung installiert werden. Die Anlagen müssen bei dem Stromlieferanten angezeigt werden.
Bei der Montage von Solaranlagen auf Dächern müssen geeignete sichere Zugänge zum Dach, Absturzsicherungen an der Traufe und am Ortgang und Maßnahmen gegen Durchsturz bei Lichtkuppeln, Dachfenstern sowie Möglichkeiten für den sicheren Materialtransport vorhanden sein. Ein Gerüst mit Treppe und Materialaufzug ist ein dafür geeignetes Arbeitsmittel. Zu beachten ist auch, dass Photovoltaikmodule mit dem Vorhandensein von Licht unmittelbar Strom erzeugen. Darum bestehen elektrische Gefährdungen, mit denen grundsätzlich nur Elektrofachkräfte umgehen dürfen.
Organisatorische Maßnahmen für den Auftragnehmer / Montagebetrieb:
• Berücksichtigen Sie bei der Angebotsabgabe die erforderlichen Absturzsicherungen (Absturz und Durchsturz).
• Überzeugen Sie den Kunden von der Notwendigkeit der Schutzmaßnahmen als Bestandteil des Angebotes. Die Anforderungen an die Montage einer PV-Anlage seitens Gesetzgeber und Unfallversicherungsträger müssen dem Auftraggeber bekannt sein.
• Legen Sie die anzuwendenden Schutzmaßnahmen und den Arbeitsablauf in einer Montageanweisung fest.
• Bestimmen Sie den aufsichtsführenden Fachbauleiter/ Montageleiter, der Sie vor Ort vertritt, schriftlich und klären Sie mit ihm alle Fragestellungen während der Ausführung der Arbeiten ab.
• Benennen Sie oder veranlassen Sie die Bestimmung eines Koordinators bei der Zusammenarbeit mehrerer Unternehmer ggf. in Absprache mit dem Auftraggeber oder Bauleiter.
• Bestimmen Sie einen Arbeitsverantwortlichen, gemäß VDE 0105-100, bzw. eine Elektrofachkraft für die Durchführung der elektrotechnischen Arbeiten.
• Veranlassen Sie die Unterweisung aller Mitarbeiter vor Ort durch den Fachbauleiter und die Besprechung des Arbeitsablaufes.
• Legen Sie die Verkehrssicherungsmaßnahmen und die Transportabläufe fest.
• Stellen Sie die Rettungskette für den Not- und Rettungsfall sicher, zur Rettung von Personen von hochgelegenen Arbeitsplätzen (DGUV Regel 112-199) sowie Maßnahmen nach elektrischer Körperdurchströmung und Störlichtbogeneinwirkung (DGUV Informationen 204-022 und
203-002)
Quelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
Aufgrund der umfangreichen Vorgaben bitte die angegebenen Links anklicken.
Montage und Instandhaltung von Photovoltaik-Anlagen
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV).
Gefährdungen bei der Montage von Photovoltaikanlagen
Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse
Photovoltaik Montage – so läuft die Installation einer PV-Anlage ab
Nadine Kümpel, wegatech greenergy GmbH
Aus diesen Gründen sollten Sie Ihre Solaranlage niemals selbst anschließen
Arne Gonschor, wegatech greenergy GmbH
Koordination bei der Installation von PV-Anlagen
ZVEH Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke
Bundesinnung für das Gerüstbauer-Handwerk/Bundesverband Gerüstbau
Photovoltaik Montage
Die Planung, Montage und Überwachung einer Photovoltaikanlage sollte grundsätzlich von einem Solarteur bzw. Solartechniker, die gute Kontakte zu entsprechenden Handwerksbetrieben (Dachdecker, Elektriker, Gerüstbauer) in der Region haben, durchgeführt werden. In der Regel sind die Solarteure in einem Dachdecker- oder Elektrobetrieb integriert. Der Anschluss an die Hauseinspeisung und das Stromnetz muss von einem registrierten und zertifizierten Elektroinstallateur erfolgen (gesetzlich vorgeschrieben). Die Kosten der Planung, Montage und elektrischer Anschluss mit Inbetriebnahme belaufen sich auf ca. 40 % der Gesamtkosten der Anlage.
Montageablauf - Aufdach-Montage (Schrägdach)
• Die Komponenten (Photovoltaikmodule, das Montagesystem, der Wechselrichter sowie gegebenenfalls ein Stromspeicher) für die Photovoltaikanlagewird auf Vollständigkeit und Brauchbarkeit überprüfen. Diese müssen an einen trockenen, frostsicheren und diebstahlsicheren Platz gelagert werden.
• Absturzsicherung (Gerüst, beim Flachdach Kantenschutz) anbringen, die die Arbeitssicherheit gewährleistet.
• Montage der Dachhaken - Dabei werden die Ziegel an dem Punkt, an dem der Dachhaken befestigt werden soll, zurückgeschoben. Anschließend wird der Haken eingesetzt und mit dem Dachsparren verschraubt. Danach werden die Ziegel wieder zurückgeschoben.
• Befestigung der Schienen - Die Montageschienen werden als Auflagepunkt für die Photovoltaikmodulen mit den Haken verschraubt.
• Auflegen der Module - Die Photovoltaikmodule werden auf die Montageschienen gelegt. Damit die Module nicht verrutschen, werden sie mit Modulklemmen fixiert. Ein Modul wird mit jeweils vier Modulklemmen befestigt. Am letzten bzw. ersten Modul einer Modulreihe werden sogenannte Endklemmen eingesetzt. Zwischen zwei Modulen verwendet man Mittelklemmen, die der Fixierung der Module auf den Schienen dienen und zwei Module miteinander verbinden.
• Kabelverbindungen - Die Module mit den Kabeln verbinden.
• Abbau der Absturzsicherung nach Dachmontageende.
• Elektroinstallation - Eine Elektrofachkraft installiert die Kabel zu den Wechselrichters und ggf. Batteriespeicher. Eine Verbindung zum Internet sollte vorhanden sein und auch nach der Installation muss der Internetanschluss weiterhin gewährleistet werden.
• Inbetriebnahme - Alle nötigen Unterlagen werden dem Netzbetreiber übergeben. Der Netzbetreiber nimmt die Anlage offiziell in Betrieb und tauscht ggf. den Stromzähler. Auch die Registrierung bei der Bundesnetzagentur im Marktstammdatenregister wird vom Solarteur bzw. Elektriker durchgeführt.
Photovoltaik Montage
Die Planung, Montage und Überwachung einer Photovoltaikanlage sollte grundsätzlich von einem Solarteur bzw. Solartechniker, die gute Kontakte zu entsprechenden Handwerksbetrieben (Dachdecker, Elektriker, Gerüstbauer) in der Region haben, durchgeführt werden. In der Regel sind die Solarteure in einem Dachdecker- oder Elektrobetrieb integriert. Der Anschluss an die Hauseinspeisung und das Stromnetz muss von einem registrierten und zertifizierten Elektroinstallateur erfolgen (gesetzlich vorgeschrieben). Die Kosten der Planung, Montage und elektrischer Anschluss mit Inbetriebnahme belaufen sich auf ca. 40 % der Gesamtkosten der Anlage.
Montageablauf - Aufdach-Montage (Schrägdach)
• Die Komponenten (Photovoltaikmodule, das Montagesystem, der Wechselrichter sowie gegebenenfalls ein Stromspeicher) für die Photovoltaikanlagewird auf Vollständigkeit und Brauchbarkeit überprüfen. Diese müssen an einen trockenen, frostsicheren und diebstahlsicheren Platz gelagert werden.
• Absturzsicherung (Gerüst, beim Flachdach Kantenschutz) anbringen, die die Arbeitssicherheit gewährleistet.
• Montage der Dachhaken - Dabei werden die Ziegel an dem Punkt, an dem der Dachhaken befestigt werden soll, zurückgeschoben. Anschließend wird der Haken eingesetzt und mit dem Dachsparren verschraubt. Danach werden die Ziegel wieder zurückgeschoben.
• Befestigung der Schienen - Die Montageschienen werden als Auflagepunkt für die Photovoltaikmodulen mit den Haken verschraubt.
• Auflegen der Module - Die Photovoltaikmodule werden auf die Montageschienen gelegt. Damit die Module nicht verrutschen, werden sie mit Modulklemmen fixiert. Ein Modul wird mit jeweils vier Modulklemmen befestigt. Am letzten bzw. ersten Modul einer Modulreihe werden sogenannte Endklemmen eingesetzt. Zwischen zwei Modulen verwendet man Mittelklemmen, die der Fixierung der Module auf den Schienen dienen und zwei Module miteinander verbinden.
• Kabelverbindungen - Die Module mit den Kabeln verbinden.
• Abbau der Absturzsicherung nach Dachmontageende.
• Elektroinstallation - Eine Elektrofachkraft installiert die Kabel zu den Wechselrichters und ggf. Batteriespeicher. Eine Verbindung zum Internet sollte vorhanden sein und auch nach der Installation muss der Internetanschluss weiterhin gewährleistet werden.
• Inbetriebnahme - Alle nötigen Unterlagen werden dem Netzbetreiber übergeben. Der Netzbetreiber nimmt die Anlage offiziell in Betrieb und tauscht ggf. den Stromzähler. Auch die Registrierung bei der Bundesnetzagentur im Marktstammdatenregister wird vom Solarteur bzw. Elektriker durchgeführt.
|
Die Güte einer PV-Anlage steht und fällt mit dem Können der Montage. Besonders wenn branchenfremde Betriebe und Selbstschrauber die Anlage montiert haben, werden Fehler gemacht. Auch eine Fortbildung zum Solarteur macht jedoch nicht aus jedem Monteur einen geeigneten PV-Installateur. Deshalb sollte man möglichst einen erfahrenen Fachbetrieb mit guten Referenzen beauftragen. Von Vorteil sind auch Erfahrungen in den Gewerken Elektroinstallations- und Dachdeckerarbeiten. Photovoltaik Montagefehler |
Die häufigsten Fehler:
.

Aufgrund der umfangreichen Vorgaben bitte die angegebenen Links anklicken.
Montageablauf einer Photovoltaikanlage - Video
EWS GmbH & Co. KG
Photovoltaik Montage - PV-Module selbst montieren und Geld sparen?
Dr. Gudrun Valerius, solaranlage-ratgeber.de - Anondi GmbH
Photovoltaik Montage – so läuft die Installation einer PV-Anlage ab
Nadine Kümpel, wegatech greenergy GmbH
Photovoltaik Montagefehler
Dr. Gudrun Valerius, solaranlage-ratgeber.de - Anondi GmbH
Typische Fehler bei der Installation von Photovoltaik-Modulen vermeiden
Dittmar Koop, haustec.de - Alfons W. Gentner Verlag GmbH & Co. KG
Die 7 häufigsten Fehler an Photovoltaikanlagen
Matthias Diehl, photovoltaikbuero Ternus und Diehl GbR

Aufgrund der umfangreichen Vorgaben bitte die angegebenen Links anklicken.
Gefährdungen bei der Montage von Photovoltaikanlagen
Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse
Solarpanele sicher montieren -
Eine saubere Sache
Andreas Warnecke, Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM)
Absturzsicherungen für Dachdecker und Solarteure
STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Absturzsicherung gesetzliche Vorschriften
Mauderer Alutechnik GmbH
Solarkataster
Solarkataster bzw. Solarpotenzialkataster sind spezialisierte Online-Plattformen oder Datenbanken spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung und der Planung von Solaranlagen (PV-Anlage, Solarthermieanlage). Sie bieten detaillierte Informationen über das Potenzial von Photovoltaik auf verschiedenen Oberflächen, insbesondere auf Dachflächen und Freiflächen. Durch die Analyse von Faktoren wie Dachneigung, Ausrichtung, Verschattung und lokalem Klima ermöglichen Solarkataster den Nutzern, das solare Energieerzeugungspotenzial eines bestimmten Standorts präzise zu bewerten.
Mit dem Solarkataster kann jeder Interessent mit nur wenigen Klicks herausfinden, ob sich das eigene Dach für die Installation einer PV-Anlage, Solarthermieanlage oder für ein Gründach eignet. Ein Konfigurationstool gibt außerdem erste Planungshinweise zu Kosten und Wirtschaftlichkeit. Für die Konfiguration einer PV-Anlage kann zwischen einem robusten Schnellcheck oder einem Expertenmodus gewählt werden.
Das Solarkataster zeigt auf Basis einer Landkarte für jedes Gebäude unter anderem die Ausrichtung des Dachs, die spezifische Sonneneinstrahlung und die mögliche Größe einer PV-Anlage. Mit Hilfe einiger Angaben, wie Bewohneranzahl, bisheriger Stromverbrauch und ob die produzierte Sonnenenergie selbst genutzt oder ins lokale Stromnetz eingespeist werden soll, berechnet das Tool die Wirtschaftlichkeit sowie einige technische Informationen. Diese unkomplizierte Wirtschaftlichkeitsberechnung berücksichtigt auch zusätzliche mögliche Verbrauchsobjekte, beispielsweise eine Wärmepumpe oder ein E-Auto. Als Ergebnis der persönlichen Angaben erhalten die User einen schnellen Überblick, wann sich die geplante PV-Anlage amortisieren würde, wie hoch die jährliche Ersparnis aufgrund der selbst genutzten oder eingespeisten Sonnenenergie wäre und wie viel CO2 eingespart werden könnte.
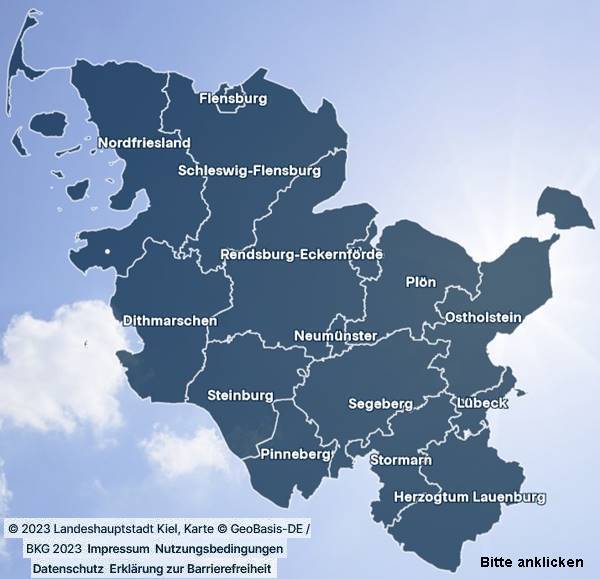 .
.
Solarkataster-SH (Karte anklicken)
Quelle: Landeshauptstadt Kiel, GeoBasis-DE, BKG
Erstes landesweites Solarkataster zeigt
geeignete Dachflächen für PV-Anlagen
Stadtwerke Kiel AG
Solardachkataster für Rendsburg-Eckernförde
Klimaschutzagentur im Kreis Rendsburg-Eckernförde gGmbH
Wie viel Energie steckt in Ihren Dächern?
tetraeder.solar gmbh
Alle Solarkataster Deutschlands im Überblick
Mein EigenHeim - J. Fink Verlag GmbH & Co. KG
Energiesparkonto
co2online gemeinnützige Beratungsgesellschaft mbH
Anmeldung - Photovoltaikanlage
Jede gewerblich genutzte und auch private Photovoltaikanlage, die ans Stromnetz angeschlossen wird, muss bei dem Stromnetzbetreiber, im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, beim Finanz- oder Gewerbeamt angemeldet werden.
Am einfachsten und sichersten ist es, wenn der Elektrofachbetrieb die Anmeldungen bei dem Stromnetzbetreiber und im Marktstammdatenregister durchführt.
Auf jeden Fall sollte man wissen, dass der Netzbetreiber und die Bundesnetzagentur (Bundesnetzbetreiber) miteinander im engen Austausch stehen. Sobald eine Anmeldung vorgenommen wird, erfährt der andere auch davon.
Anmeldung beim Netzbetreiber
Quelle: Schleswig-Holstein Netz AG
In 9 Schritten zu Ihrem Sonnenstrom
1. Anmeldung mit Ihrem Elektroinstallateur
2. Prüfung der Unterlagen durch Schleswig-Holstein Netz
3. Netzberechnung durch Schleswig-Holstein Netz
4. Einspeisezusage durch Schleswig-Holstein Netz
5. Rücksendung Betreiberbestätigung
6. Mitteilung Zählpunkt durch Schleswig-Holstein Netz
7. Fertigmeldung durch Ihren Elektroinstallateur
8. Zählersetzung durch Schleswig-Holstein Netz
9. Vergütung Ihres eingespeisten Stroms durch Schleswig-Holstein Netz
Bei Mini-PV-Anlagen bzw. Balkonkraftwerken ist das einfacher
Anmeldung bei der Bundesnetzagentur
Die PV-Anlage muss bei der Bundesnetzagentur1 in das Marktstammdatenregister2 (MaStR) eingetragen werden. Dies ist ein umfassendes, amtliches Register für alle stromerzeugenden Anlagen, (Blockheizkraftwerke, Solaranlagen, Batteriespeicher, KWK-Anlagen, Notstromaggregate). Der Sinn und Zweck des Registers ist, alle Informationen zum Strommarkt in einer einzigen Datenbank zu sammeln, zu bündeln und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Die genauen Standorte und Leistungen der privaten Anlagen haben Einfluss auf die Sicherheit und den Ausbau des öffentlichen Stromnetzes.
Die Anmeldungsfrist einer Solaranlage und eines Batteriespeichers ist relativ kurz. Eine Neuanlage, die ab Februar 2019 in Betrieb genommen wurde, muss innerhalb von einem Monat nach Inbetriebnahme ins Register eingetragen worden sein. Der Batteriespeicher muss separat innerhalb einer 1-Monats-Frist nach Inbetriebnahme angemeldet werden. Das gilt sowohl für bereits laufende Stromspeicher sowie für einen neu angeschafften.
1 Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen ist eine selbstständige Bundesoberbehörde. Sie hat in erster Linie den Auftrag, durch Regulierung in den Zuständigkeitsbereichen den Wettbewerb zu fördern und einen diskriminierungsfreien Netzzugang zu fairen Bedingungen zu gewährleisten.
Im Rahmen der Energieregulierung sind die zentralen Aufgaben insbesondere die Genehmigung der Netzentgelte für die Durchleitung von Strom und Gas, die Beseitigung von Hindernissen beim Zugang zu den Energieversorgungsnetzen für Lieferanten und Verbraucher, die Standardisierung von Lieferantenwechselprozessen und die Verbesserung von Netzanschlussbedingungen für neue Kraftwerke.
Die Bundesnetzagentur nimmt u.a. die Aufgabe wahr, in Verkehr zu bringende oder in Verkehr gebrachte elektrische Geräte oder Funkanlagen stichprobenweise auf Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen zu prüfen ist. Das Register für den deutschen Strom- und Gasmarkt. Auch das Marktstammdatenregister (MaStR) wird von der Bundesnetzagentur geführt.
2 Mit dem Marktstammdatenregister (MaStR) wird ein umfassendes behördliches Register des Strom- und Gasmarktes aufgebaut, das von den Behörden und den Marktakteuren des Energiebereichs (Strom und Gas) genutzt werden kann. Für viele energiewirtschaftliche Prozesse stellt das einheitliche und vollständige Register eine Vereinfachung und eine deutliche Steigerung der Datenqualität dar.
Behördliche Meldepflichten können durch die zentrale Registrierung vereinheitlicht, vereinfacht oder ganz abgeschafft werden. Das MaStR dient damit auch der Entlastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen bei den zahlreichen Meldepflichten.
Marktstammdatenregister |
|
Art der Einheiten |
Registrierungspflicht |
Strom- und Gaserzeugungs- |
Einheiten die unmittelbar oder mittelbar ans Strom- oder Gasnetz angeschlossen sind oder werden sollen |
Strom- und Gasspeicher |
Einheiten die unmittelbar oder mittelbar ans Strom- oder Gasnetz angeschlossen sind oder werden sollen |
Stromverbrauchseinheiten |
Einheiten die an ein Hoch- oder Höchstspannungsnetz angeschlossen sind |
Gasverbrauchseinheiten |
Einheiten an Fernleitungsnetze angeschlossen sind Außerdem: Gaskraftwerke mit einer elektrischen Leistung > 10 MW |
Verpflichtend zu registrierende Stromerzeugungsanlagen
Die Registrierung ist grundsätzlich für alle ortsfesten Stromerzeugungs-Anlagen verpflichtend, unabhängig von der Größe und vom Inbetriebnahmedatum und unabhängig davon, ob für den Strom eine Förderung nach dem EEG oder nach dem KWKG in Anspruch genommen wird. Die Pflicht gilt für alle Anlagen, die Strom für die Einspeisung in das öffentliche Stromnetz oder für den eigenen Verbrauch erzeugen.
• Solaranlagen
• Stromspeicher
• Windenergieanlagen
• Biomasseanlagen
• Wasserkraftanlagen
• Anlagen zur Stromerzeugung aus Geo- oder Solarthermie, Grubengas, Klärschlamm, Druckentspannung
• Verbrennungsanlagen einschließlich KWK-Anlagen und Brennstoffzellen
Marktstammdatenregister (MaStR)
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Eine PV-Anlage anmelden: Bundesnetzagentur, Betreiber und Finanzamt
Solarwatt GmbH
Welche Daten werden im Marktstammdatenregister erfasst?
Solarwatt GmbH
PV-Anlage anmelden: Schritt-für-Schritt Anleitung
Enpal B.V.
Photovoltaikanlagenbetreiber sollten sich darüber im Klaren sein, das das Betreiben einer Photovoltaikanlage ein Gewerbe darstellen kann. Von einer Gewerbeanmeldung ist man befreit, wenn der erzeugte Strom ausschließlich dem Eigenverbrauch dient (Off-Grid-System) oder diesen nur in einem geringen Umfang in das öffentliche Stromnetz einspeist. Dabei handelt es sich in der Regel um PV-Systeme, deren Leistung 5 kWp nicht übersteigen.
Obwohl die Einspeisung von Strom eine gewerbliche Tätigkeit darstellt, ist eine Gewerbeanmeldung für Photovoltaikanlagen auf privaten Wohngebäuden nur in wenigen Ausnahmefällen erforderlich. Dies entscheiden in Grenzfällen die Bundesländer. Diese haben sich auf eine einheitliche Vorgehensweise geeinigt. Der Betrieb einer PV-Anlage wird nicht als gewerbliche Tätigkeit eingestuft. Hier sollte aber unbedingt beachtet werden, dass dies nur für das Gewerberecht gilt. Die Gründe sind darin zusehen, dass der jährliche Gewinn einer Kleinanlage für eine gewerbliche Tätigkeit sehr gering ist, weil die Abschreibungsmöglichkeiten der Investition in die Rechnung einbezogen werden und der Netzbetreiber in der Regel der einzige Abnehmer ist. Wenn aber der Strom z. B. an einen benachbarten Abnehmer (z. B. Gewerbetrieb) geliefert wird, kann eine Gewerbeanmeldung notwendig werden. Es sollte immer bei der Gemeinde nachgefragt werden, ob eine Gewerbeanmeldung erforderlich ist.
Aber steuerrechtlich sind die Einnahmen aus der Einspeisevergütung Einkünfte aus einer gewerblichen Tätigkeit und sind als Einkommen zu versteuern. Die laufenden Kosten und der Kaufpreis der PV-Anlage, z. B. linearen Abschreibung > jährlich 5 %, können abgesetzt werden.
Da das Betreiben einer PV-Anlage eine unternehmerische Tätigkeit ist, muss für die erhaltene Einspeisevergütung eine Umsatzsteuer von 19 % an das Finanzamt abgeführen werden. Diese wird aber nur weitergereicht, da der Anlagenbetreiber diese Umsatzsteuer dem Netzbetreiber in Rechnung stellt. Diese eingenommene Umsatzsteuer muss in den ersten zwei Jahren monatlich dem Finanzamt in einer "Voranmeldung" gemeldet und sofort abgeführt werden. Danach sind längere Intervalle, abhängig vom Jahresumsatz, für die Voranmeldung möglich. Von der abzuführenden Umsatzsteuer können die Beträge abgezogen werden, die im Rahmen der Tätigkeit selbst als Umsatzsteuer (Vorsteuer) gezahlt werden. Da eine private Photovoltaikanlage der Umsatzsteuerpflicht unterliegt und die Einnahmen einkommenssteuerpflichtig sind, ist es empfehlenswert, in den ersten zwei Jahren die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch zu nehmen. So können auch alle möglichen Abschreibungsmöglichkeiten genutzt und die Verfahrensgänge gelernt werden.
Hier könnte auch geklärt werden, ob die Kleinunternehmerregelung (weniger als 17.500 € Umsatz)
in Anspruch genommen werden sollte. Dann muss keine Umsatzsteuer (nur Einkommensteuer) an das Finanzamt abgeführt werden, aber es kann dann keine Vorsteuer gezogen werden.
Gewerbe anmelden bei einer PV-Anlage
PV-Forum - Photovoltaikforum GmbH - wertvolle Hilfen durch Fachleute
Gefährliches Halbwissen - Falsche Tipps und unvollständige Informationen
über Photovoltaik-Anlagen
Öffentliche Nettostromerzeugung in Deutschland in 2022
- energy-charts.info - Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE
Alle reden von der Energiewende. Aber wie macht man die?
Solarwatt GmbH
Operation Sunplant - So bauen Sie kleine (und große) Balkonkraftwerke
Andrijan Möcker, c´t Magazin für Computertechnik - Heise Medien GmbH & Co. KG
Es gibt so viele Ideen, erneuerbare Energie (PV-Anlagen, Windkraft) zu nutzen.
Warum wird das nicht umgesetzt?
Strom statt Gas: Kieler Forscher wollen ungenutzte Windenergie einspeisen
Hauke von Hallern und Josefine Kasten, Norddeutscher Rundfunk
Dringend ist ein Ende der Regulierungswut sowie ein Aussetzen zeitraubender Genehmigungsverfahren notwendig.
Kaskadenmessung - PV - HH - WP
Wenn man den Strom für die Wärmepumpe durch einen günstigen Wärmepumpenstromtarif bezieht und zusätzlich noch eine PV-Anlage besitzt, der möchte auch seinen eigenen Strom für die Wärmepumpe verwenden. Hier kann eine Kaskadenmessung eingesetzt werden.
Die Kaskadenmessung ist noch nicht so weit verbreitet und wird von vielen Netzbetreibern nicht mal wirklich angeboten. Hier ist aber wichtig zu wissen, dass die Auswahl vom Messkonzept definitiv beim Anlagenbetreiber liegt. Der Netzbetreiber hat wiederum die Verpflichtung, das gewählte Messkonzept auf Konformität mit dem EEG, KWKG und den Technischen Anschlussbedingungen zu prüfen. Die Kaskadenmessung ist definitiv ein konformes Messkonzept und wird hoffentlich in Zukunft noch mehr Aufmerksamkeit bekommen, damit diese auch als offizielles Messkonzept angesehen wird und auch die Umsetzung kein Problem mehr darstellt.
FAQ - Häufige Fragen zu Erneuerbare Energien
Schleswig-Holstein Netz AG
Die Kaskadenmessung: PV Anlage mit Wärmepumpe
Photovoltaikforum GmbH
PV-Anlagen - Blitzschutz - Überspannungsschutz
Bei der Installation einer Photovoltaik-Anlage oder spätestens nach einem Blitzschaden stellt sich die Frage, ob der Blitzschutz für die Photovoltaik-Anlage notwendig ist. Hier sind die baulichen Gegebenheiten der PV-Anlage und des Gebäudes, auf dem diese installiert wird, zu berücksichtigen. Eine Beschreibung der Schutzmaßnahmen sowie eine Entscheidungshilfe enthält die Blitzschutz-Norm DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) im Beiblatt 5 "Blitz- und Überspannungsschutz für PV-Stromversorgungssysteme".
Photovoltaik-Anlagen sind sowohl durch direkte als auch durch nahe Blitzeinschläge gefährdet, denn dabei entstehen hohe Spannungen und Ströme, die auf das PV-Stromversorgungssystem einwirken können.
• Direkteinschläge: Werden Photovoltaik-Anlagen direkt von Blitzen getroffen, fließen sehr hohe Blitzströme über die Photovoltaik-Anlagen, die dabei häufig zerstört werden; auch mechanische Zerstörungen und Brände sind nicht auszuschließen.
• Indirekte Einschläge: Bei nahen Blitzeinschlägen fließen Blitzteilströme über die elektrischen Installationen und Versorgungsleitungen, die in Photovoltaik-Anlagen große Schäden hervorrufen können.
• Bei Blitzeinschlägen in einer Entfernungen bis 500 m erzeugen die hohen magnetischen Felder des Blitzes in elektrischen Installationsschleifen Überspannungen, die Schäden an Photovoltaik-Anlagen verursachen können.
• Bei Blitzeinschlägen in größerer Entfernung können allenfalls kapazitive Einwirkungen auftreten, die in der Regel keine Schäden hervorrufen.
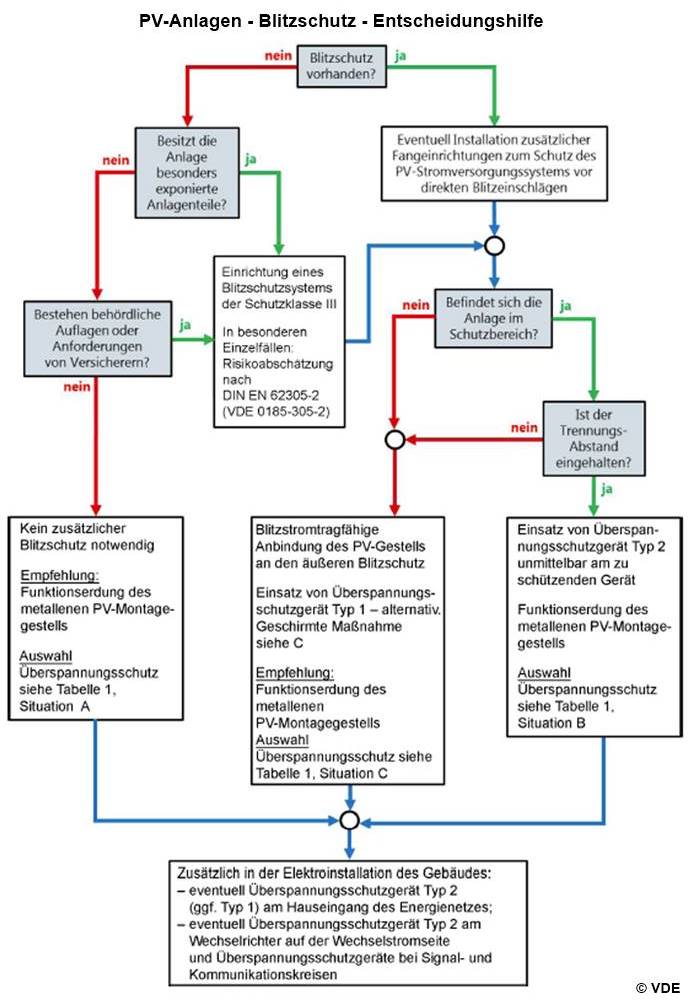
Blitzschutz von Photovoltaik-Anlagen
VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.
Blitz- und Überspannungsschutz für Aufdachanlagen
DEHN SE
Schutzkonzept für PV-Anlagen
DEHN SE
Prüfung des Blitzschutzsystems
DEHN SE
hier ausführlicher >>> Blitzschutz - nicht nur für Solaranlagen
![]() Bei der Montage von PV-Module in Verbindung mit bzw. an Holz- und Kunststoffteilen muss unbedingt dessen Zündtemperatur beachtet werden.
Bei der Montage von PV-Module in Verbindung mit bzw. an Holz- und Kunststoffteilen muss unbedingt dessen Zündtemperatur beachtet werden.
Ob der Elektrosmog (elektromagnetische Strahlung) durch eine Photovoltaikanlage, der durch elektromagnetische Felder (elektrische Gleichfelder, magnetische Gleichfelder, elektrische Wechselfelder, magnetische Wechselfelder) entsteht, krank machen kann, wird zunehmend gestrittig diskutiert.
Die einen sagen, dass die elektrischen und magnetischen Felder sich im Bereich von 9 - 3000 kHz befinden und sich nicht von elektronischen Haushaltsgeräten unterscheiden und die Feldstärke bereits nach wenigen Zentimetern stark abnimmt und somit für die Gesundheit unbedenklich ist.
Die anderen sagen, dass die PV-Anlagen Elektrosmog verbreiten können, wenn sie nicht richtig installiert und angeschlossen werden. Vor allem erzeugen Wechselrichter erhebliche magnetische Wechselfelder, deren Stärke von der Sonneneinstrahlung abhängig ist und in grossem Abstand zu tags- und nachtsüber benutzten Räumen installiert werden sollten.
Da der Elektrosmog nicht nur tagsüber verursacht, sondern 24 Stunden ohne Unterbrechung (also auch, wenn kein Strom erzeugt wird) entsteht. Wenn der Wechselrichter am Netz bleibt, leitet er auf alle Installationen und alle Gebäudeteile Strom. Es wurde festgestellt, dass auf dem Netz massive, breitbandige Störstrahlungen vorhanden sind. Auch wenn die Solaranlage auf einem Nachbargebäude betrieben wird. Diese Magnetfelder können durch geeignete Messungen festgestellt und minimiert werden, wenn z. B. das Verbindungskabel zwischen Solarzelle und Wechselrichter verdrillt werden. Außerdem sollten unnötige Potentialdifferenzen vermieden werden.
Diese Maßnahmen gegen Elektrosmog sind immer zu empfehlen:
• Möglichst viel Abstand zu tagsüber genutzten Räumen
• Erdung der Module
• Geringe Leiterschleifen
• Abgeschirmte geerdete Stringleitungen oder Verlegung in geerdeten Rohren
• Positionierung des Wechselrichters möglichst weit weg von Daueraufenthaltsplätzen (Bett, Büroarbeitsplatz)
• Verbindungskabel zwischen Solarzelle und Wechselrichter verdrillen
• unnötige Potentialdifferenzen vermeiden
• Aluminium-Folie an der Modulrückseite
• Wechselrichter mit Transformator (Gleichstromseite und Wechselstromseite galvanisch trennen)
• Wechselrichter mit Netzfilter auf Gleich- und Wechselstromseite oder Installation zusätzlicher externer Netzfilter
• Wechselrichter weit weg von Ruhezonen (z. B. im Keller abgeschirmt)
• Solarleitungen (+ und -) in geringem Abstand zueinander verlegen
• Gleichstromleitungen fernab von Wechselspannungsleitungen verlegen
Elektromagnetische Strahlung einer Photovoltaik Anlage
Christian Märtel, DAA GmbH
Photovoltaikanlagen und Elektrosmog?
Werner Bopp, baubiologie magazin - Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit IBN Unabhängige private GmbH
PV-Elektrosmog: Krank durch Photovoltaikanlagen?
Kai Janßen, grünes.haus.de
Photovoltaik-Elektrosmog: Wie gefährlich ist Solaranlage-Strahlung?
energie-experten.org - Greenhouse Media GmbH
Schutz vor Elektrosmog – Photovoltaikanlage richtig abschirmen
Christian Schaar, S2 GmbH - J.Fink Verlag GmbH & Co. KG
Elektrosmog - Torsten Mey
Mieterstrom
Mieterstrommodelle ("Quartierstrom") sind Vermarktungsmodelle für Strom, der vor Ort mit einer PV-Anlage, einem BHKW oder einer Windkraftanlage erzeugt, an die Hausbewohner ("Mieter") ohne Nutzung des Netzes der allgemeinen Versorgung geliefert und im Gebäude verbraucht wird. Diese Modelle werden seit einigen Jahren angeboten. Sie sollen private Vermieter dazu ermuntern, die Dächer ihrer Häuser mit PV-Anlagen zu bestücken und den grünen Strom günstig an die Mieter zu verkaufen.
Neben dem privaten Vermieter können auch folgende Anbieter das Mieterstrommodell nutrzen:
• Wohnungsunternehmen
• Wohnungsgenossenschaften
• Tochtergesellschaften
• Energiegenossenschaften
• Mieterstrom-Dienstleister
Der Grund, warum die Modelle nicht angenommen wurden, war wohl, dass sich der Mieterstrom in der Regel für Vermieter nicht gerechnet hat, weil zusätzliche Kosten für Abrechnung, Vertrieb und Messungen entstehen. Um Mieterstrom wirtschaftlich attraktiver zu machen, hat der Bundestag am 29. Juni 2017 das Gesetz zur Förderung von Mieterstrom verabschiedet. Der Bundesrat hat dieses Gesetz am 7. Juli 2017 beschlossen. Das Gesetz ist am 24. Juli 2017 verkündet worden und am 25. Juli 2017 in Kraft getreten.
Im Gesetz
zur Förderung von Mieterstrom und zur Änderung weiterer Vorschriften des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017) wird ein Förderanspruch für direkt gelieferten Strom aus Solaranlagen auf Wohngebäuden verankert. Danach erhält der Betreiber einer solchen Anlage einen Mieterstromzuschlag. Dieser orientiert sich an den im EEG genannten Einspeisevergütungen abzüglich eines Abschlags. Um die durch die Mieterstromförderung entstehenden zusätzlichen Kosten zu begrenzen, wird der durch den Mieterstromzuschlag förderfähige Zubau von Solaranlagen auf 500 Megawatt pro Jahr beschränkt.
Wichtig ist, dass der Mieter seinen Stromanbieter weiterhin frei wählen kann und Mieterstrom zu attraktiven Konditionen angeboten bekommt. Daher beinhaltet das Gesetz Vorgaben für die Laufzeit des Mieterstromvertrags, verbietet die Kopplung mit dem Mietvertrag und sieht eine Preisobergrenze für Mieterstrom vor.
Mieterstromvertrag
Als Mieterstromvertrag wird ein Vertrag zur Lieferung von Strom bezeichnet, der direkt zwischen Ihnen als Mieterstrom-Nutzer*in und dem Anlagenbetreiber oder einem Dritten (falls die Anlage nach dem 01.01.2021 in Betrieb genommen wurde) als Mieterstromlieferant abgeschlossen werden kann. Anlagenbetreiber kann Ihr Vermieter (z.B. eine Einzelperson oder Genossenschaft), aber auch ein spezieller Mieterstrom-Dienstleister sein. Der Energieliefervertrag ist mit einem wettbewerblichen Energieliefervertrag vergleichbar, wie man ihn auch mit einem anderen Energielieferanten abschließen würde.
Bei dem gefördertem Mieterstrom sind folgende Besonderheiten zu beachten:
Stromquelle und räumliche Nähe |
Der geförderte Mieterstrom ("Quartierstrom") darf nur aus Solaranlagen auf dem Dach des Wohngebäudes (bzw. in räumlicher Nähe) stammen, wo er dann auch verbraucht wird. Bei Anlagen, die nach dem 01.01.2021 in Betrieb genommen werden, darf der Strom auch in dem Quartier* verbraucht werden, in dem das Gebäude liegt. |
ohne Nutzung des Netzes der allgemeinen Versorgung |
Der Strom muss ohne die Nutzung des Netzes der allgemeinen Versorgung direkt an Sie geliefert werden. Überschüssig erzeugter Strom, der nicht im Wohnhaus verbraucht wird, kann ins Netz eingespeist werden.. |
Zusatzstrom |
Zusätzlich benötigter Strom, der nicht durch die Solaranlage erzeugt werden kann, wird Ihnen ebenfalls vom Mieterstromlieferanten geliefert. Er übernimmt grundsätzlich die volle Verantwortung für Ihre gesamte Stromlieferung mit den entsprechenden gesetzlichen Rechten und Pflichten. |
spezielle Regelungen |
Die wichtigsten Regelungen zum speziellen Vertragsverhältnis einer Mieterstrom-Lieferung finden Sie als Mieterstrom-Nutzer*in in § 42a EnWG. Dort sind u.a. die Vertragsbedingungen, Preisgrenzen und eine Gewährleistung der umfassenden Stromversorgung festgelegt. |
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (2021) hat das Lieferkettenmodell auch rechtlich gestärkt. Gemäß § 21 Absatz 3 EEG 2021 liegt Mieterstrom im gesetzlichen Sinne auch dann vor, wenn der Strom nicht vom Anlagenbetreiber, sondern wie im Fall des Lieferkettenmodells von einem Dritten geliefert wird.
Mieterstrom - Bundesnetzagentur
Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG)
§ 42a Mieterstromverträge
Mieterstromzuschlag - Bundesnetzagentur
Umfangreicher Ratgeber "Mieterstrom":
Wie können sich Mieter mit Solarstrom versorgen?
- energie-experten.org, Greenhouse Media GmbH
Solaranlage kaufen oder mieten*
Viele Hauseigentümer haben ein Dach und/oder eine Freifläche, welche sich für die Installation einer Photovoltaikanlage eignet. Oft haben sie keine finanziellen Mittel oder keinen Mut für die Investition in eine Photovoltaikanlage. Das klassische Kauf-Modell ist für immer mehr Hausbesitzer nicht mehr die beste Option. Als Alternative hat sich vor allem das innovative Miet-Modell etabliert.
• Wer am liebsten alles selbst macht, keinen Kredit benötigt und sein Erspartes nicht investieren möchte, für den ist das klassische Kauf-Modell eine gute Option.
• Wer eine PV-Anlage mietet, schätzt das Rundum-Sorglos-Paket, 0 € Anschaffungskosten und die Kostentransparenz.
• Bei einem ehrlichen Vergleich sind die Kostenunterschiede je nach Anlagengröße und Rechenweise meist eher gering und hängen davon ab, wie genau man rechnet und welche Faktoren man einbezieht.
* Ein Mietvertrag ein ein gegenseitiger schuldrechtlicher Vertrag zur zeitweisen Gebrauchsüberlassung gegen Entgelt. Dieser ermöglicht dem Mieter den Gebrauch an der gemieteten Sache. Die Gegenleistung des Mieters besteht darin, die im Vertrag vereinbarte Miete zu zahlen.
Obwohl der Kauf einer Photovoltaikanlage einige Vorteile (Förderungen von Staat und/oder Bundesland, selbsttragende Energiegewinnung ohne Mehrbelastung) hat, ist das nicht immer zu empfehlen. Ein Grund dafür sind die hohen Anschaffungskosten. Bei einem Einfamilienhaus zahlt man für die Anschaffung einer Photovoltaik-Komplettanlage deutlich über 10.000 €. Eine Anlage mit einer Leistung von z. B. 8,1 Kilowatt (kWp) kostet nach Angaben der Verbraucherzentrale aktuell etwa 13.000 € (Stand: Mai 2022). Ein weitere Gründe sind die Installations- und Betriebskosten ( Wartung, Inspektion, Reparatur, Reinigung der Anlage, Versicherung). Viele Hersteller verlangen außerdem ein smartes Monitoring.
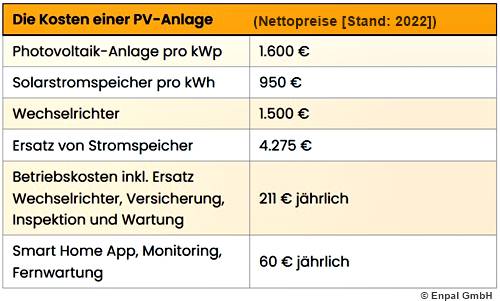
Preise in netto, ohne Inflation. Wechselrichter und Stromspeicher sollten nach 10 - 15 Jahren ersetzt werden. Aufgrund von verschiedenen Faktoren ändern sich die Preise momentan stärker und schneller als in der Vergangenheit.
Quellen: HTW Berlin, Fraunhofer ISE, BSW/EUPD Preismonitor, ZSW und Verbraucherzentrale.
Enpal bietet die PV-Anlagen im Miet-Modell an. Das Besondere dabei ist, es gibt keine Anschaffungskosten und das Rundum-Sorglos-Paket (Beratung, Planung, Installation, Wartung, Reparatur und Versicherung) ist inklusive.
Die Miete für eine PV-Anlage liegt zwischen 114 € und 202 € pro Monat. Je größer die Anlage, desto höher der monatliche Mietpreis. Optional wird auch ein Solarstromspeicher und eine Wallbox angeboten. Die Miete bleibt über eine Laufzeit von 20 Jahren stabil und steigt auch bei höherer Inflation nicht an.
Bei den Anbietern muss u.a. darauf geachtet werden, wann die erste Miete fällig ist und was nach Ablauf der Vertragslaufzeit mit Ihrer Solaranlage passiert. Häufig müssen die monatlichen Preise schon vor Inbetriebnahme der Anlage bezahlt und nach 20 Jahren muss die Solaranlage entweder wieder abgeben oder überteuert beim Anbieter abgekauft werden.
Im Mietmodell von Enpal beginnen die monatlichen Mietpreise für die PV-Aanlage bei 114 €. Die Miete ist erst dann fällig, sobald die Photovoltaikanlage in Betrieb ist und Strom erzeugt. Eine weitere Besonderheit ist, dass Sie die PV-Anlage nach 20 Jahren für einen symbolischen Euro (fast) geschenkt bekommen. Bei einer Lebensdauer von 30 bis 40 Jahren sind das nach Vertragsende also nochmals 10 bis 20 Jahre kostenfreie Nutzung. Die Anlage kann aber auf Wunsch auch nach Ende der Mietdauer kostenfrei von Enpal rückgebaut und abheholt werden. Quelle: Enpal GmbH
Solaranlage kaufen oder mieten
Solaranlage mieten: Lohnt sich das Modell? - Alle Vorteile und Nachteile
Solaranlage kaufen oder mieten - Was ist besser?
Yannick Van Noy, Enpal GmbH
Miete und Pacht
Wo liegen die Unterschiede?
HAUSGOLD - talocasa GmbH
Dachverpachtung
Viele Hauseigentümer haben ein Dach und/oder eine Freifläche, welche sich für die Installation einer Photovoltaikanlage eignet. Oft haben sie keine finanziellen Mittel oder keinen Mut für die Investition in eine Photovoltaikanlage. Hier gibt es die Möglichkeit, die Dachfläche an Solarinvestoren zu verpachten bzw. zu vermieten. Der Eigentümer hat Erträge durch die Pachtzahlung und je nach Pachtvertrag geht die Anlage nach dem Auslaufen des Vertrages in das Eigentum des Dacheigentümers über. Außerdem ist das Dach der Witterung weniger ausgesetzt.
* Ein Pachtvertrag ist eine vertraglich vereinbarte Überlassung einer Sache auf Zeit zur Nutzung und Fruchtgenuss. Als Gegenleistung für die Nutzung dieses Gegenstandes auf Zeit zahlt der Pächter ein bestimmtes Entgelt an den Verpächter. Der Unterschied zwischen Pacht und Miete besteht in der sogenannten Fruchtziehung. Im Gegensatz zum Pächter hat der Mieter keine Möglichkeit gemachte Erträge und Gewinne für sich selbst zu beanspruchen.
Wenn sich der Hauseigentümer für eine Verpachtung entscheidet, dann sollte er folgendes bedenken.
-
Bei der langfristigen Dachverpachtung besteht oft eine Klausel, dass der Vertrag z. B. nach zwanzig Jahren um weitere Jahre verlängert werden kann.
-
Für die Laufzeit der Dachverpachtung werden im Vertrag Umbaumaßnahmen, die das Dach betreffen (Dachfenster, Gauben) ausgeschlossen.
-
Die steuerrechtliche Handhabung (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung) muss geklärt werden.
-
Bei der Dachverpachtung sichert sich der Eigentümer der PV-Anlage in der Regel durch die Eintragung einer Dienstbarkeit in das Grundbuch ab. Wenn eine Dienstbarkeit eingetragen ist, lässt sich aber das Haus schlechter verkaufen oder beleihen. Auch kann die finanzierende Bank des Hauses, ihr Einverständnis verweigern, wenn das Haus durch eine Hypothek belastet ist.
Bei der Dachverpachtung gibt es verschiedene Vergütungsmodelle.
-
jährlicher Pachtzahlung abhängig vom Ertrag an Solarstrom
-
jährlicher Pachtzahlung abhängig von der installierten Leistung in Kilowatt Peak (kWp)
-
jährliche Pauschalzahlung je nach Größe der Anlage und belegter Dachfläche (Einmalzahlung).
Die Verpachtung an Landwirte (Energiewirt) und auf gewerblichen Gebäuden wird schon seit Jahren durchgeführt.
Dachverpachtung - Photovoltaik.org, ub.de Fachwissen GmbH
Miete und Pacht - Wo liegen die Unterschiede?
HAUSGOLD - talocasa GmbH
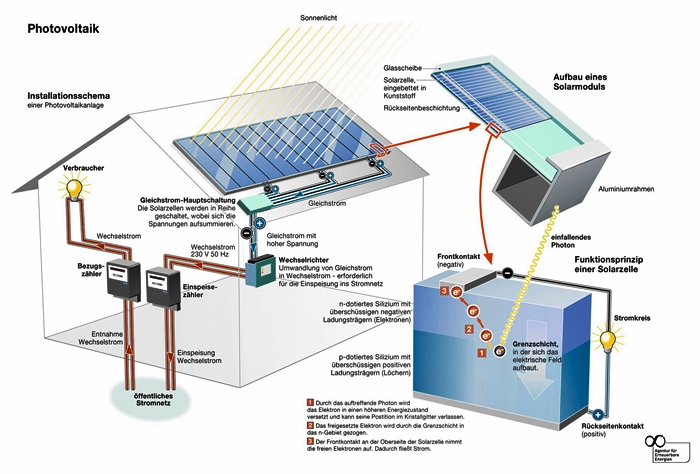
Funktionsweise einer Photovoltaikanlage (Bild durch Anklicken vergrößer)
Quelle: Agentur für Erneuerbare Energien - DAA Deutsche Auftragsagentur GmbH
Drohnenprüfung an PV- und Solaranlagen
viZaar industrial imaging AG
Bauteile
einer PV-Anlage
Eine Photovoltaik-Anlage besteht aus mehreren Solarmodulen, einer Gleichstrom-Hauptschaltung, einem Wechselrichter (Netzeinspeisegerät [NEG]) und Einspeisezähler. Der Stromerzeugungsprozess wird durch das Einfallen des Sonnenlichts in Gang gesetzt. Bei diesem Strom, der aus mehreren in Reihe geschalteteten Solarzellen kommt, handelt es sich um Gleichstrom, der in der Hauptschaltung zusammengefasst bzw. aufsummiert wird. Danach wird aus dem hochspannigen Gleichstrom in einem Wechselrichter gebrauchsfähiger Wechselstrom (230 V 50 Hz) hergestellt. Dieses Gerät regelt den Strom und die Spannung so, dass die PV-Anlage besonders leistungsfähig arbeitet. Der erzeugte bzw. in das öffentliche Stromnetz einspeiste Strom wird im Einspeisezähler angezeigt.
>>>> hier ausführlicher <<<<
*
Watt Peak (Kilowatt Peak - kWpp)
Die Maßeinheit "Watt Peak" (Wp)
bzw. ("Kilowatt Peak" - kWp) wird speziell in der Photovoltaik zur Kennzeichnung
der genormten elektrischen Leistung (Nennleistung)
einer Solarzelle oder eines Solarmoduls
eingesetzt. Sie gibt maximal mögliche Leistung
bei Standardbedingungen an und wird deshalb als Peak-Leistung
(Spitzen-Leistung) benannt. Diese wird in
Watt bzw. Kilowatt gemessen und als Wp (Watt, Peak)
bzw. kWp (Kilowatt, Peak) angegeben. Zum Vergleich verschiedener Solarzellen
oder Solarmodule ist eine Normierung notwendig.
Die Standardbedingungen (Test- bzw. Laborbedingungen)
für die Normierung sind eine optimale
Sonneneinstrahlung von 1.000 W/m2
bei einer Modultemperatur von 25 °C
und einem Air Mass
(AM)* 1,5
(Luftmasse bzw. Sonnenlichtspektrum). Die tatsächliche
abgegebene Leistung ist aber ca. 15 bis 20
% niedriger, weil sie in der Praxis eine wesentlich
höhere Betriebstemperatur haben und der Einfallswinkel
der Zellen meistens nicht genau senkrecht
zum einfallenden Licht ausgerichtet ist.
kWp - Kilowatt Peak
* Air Mass (Luftmasse
bzw. Sonnenlichtspektrum)
Die Länge des Weges, den das Sonnenlicht
durch die Erdatmosphäre bis zum Erdboden zurücklegt wird mit
dem relativen Maß Luftmasse (Air Mass
[AM]) bezeichnet. Der Einfallswinkel des Sonnenlichts
ändert sich durch die Drehung der Erde um die Sonne und damit ändert
sich auch die Länge des Weges durch die Atmosphäre. Dadurch
ergibt sich die Minderung der Sonnenstrahlung durch Streuung, Reflexion,
Absorption und die Veränderung seiner spektralen Zusammensetzung.
Die verschiedenen Spektren sind
|
|
Das
Referenzspektrum für die Vermessung
von Solarmodulen in Photovoltaikanlagen
in Mitteleuropa ist AM 1.5. |
|
Dunkelflaute
Die Dunkelflaute (wenig oder keine Sonne, wenig oder kein Wind) und die "kalte" Dunkelflaute (wenig oder keine Sonne, wenig oder kein Wind, hohe Stromnachfrage [Winter]) sind eine Hürde der Energiewende, denn ein Totalausfall von Wind und Sonne gefährden die Versorgungssicherheit mit Strom und Wärme.
Im Rahmen der Energiewende, die aufgrund des Klimawandels notwendig ist, werden die Erneuerbare Energien (Windkraft, Photovoltaik) den Hauptanteil der Energieversorgung übernehmen und die konventionellen Energieträger (Erdöl, Erdgas, Kohle, Holz, Atomkraft) ersetzen. Wie sieht es aber aus, wenn über Tage hinweg kein Wind weht und es eine längere Zeit keine Sonne scheint? Die bestehenden Biogasanlage und die eventuell vorhandene Wasserkraftwerke werden den notwendigen Bedarf energetischer Nutzung (Strom, Wärme, Verkehr, Produktherstellung und Grundstoffindustrie) nicht zur Verfügung stellen können. Hier ist der Einsatz von Energiespeichern notwendig.
In systemrelevante Bereichen (z. B. Krankenhäuser, Arztpraxeb, Altenheime, Wassererke, Tankstellen) sind auch Netzersatzanlagen (Notstromaggregate) installiert. Diese sind nicht für eine dauerhafte und klimaneutrale Stromerzeugung geeignet, können aber reaktionsschnell kurzfristig auftretende Spitzen abfangen. Die Netzersatzanlagen werden in Virtuellen Kraftwerken (Ein Zusammenschluss von dezentralen Einheiten im Stromnetz, die über ein gemeinsames Leitsystem koordiniert werden) zum Ausgleich von Netzfrequenzschwankungen genutzt. Im Notfall kann auch Wärme und Kälte gemietet werden.
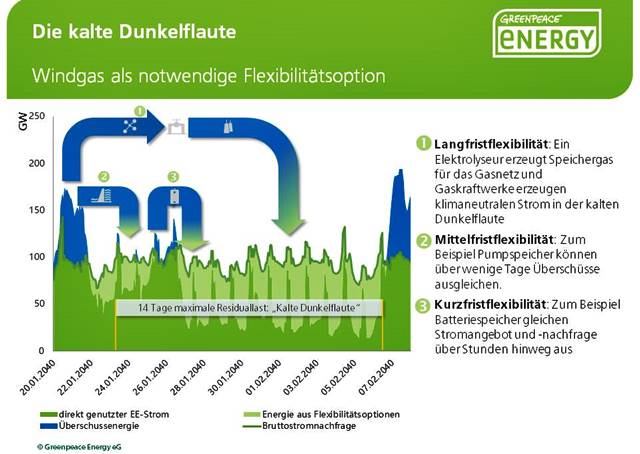
Ausgleich in der "kalten Dunkelflaute"
Kalte Dunkelflaute - Robustheit des Stromsystems bei Extremwetter
- F. Huneke, C. Perez Linkenheil, M. Niggemeie - Greenpeace Energy eG
Dunkelflaute: Wie ernst ist der Ausfall von Wind & Solar?
- Florian Blümm, Tech for Future
Mini-PV-Anlagen werden auch "Stecker-Solar-Gerät", "Balkon-Solarmodul" "Plug-and-Play"-Photovoltaikanlage oder
"Guerilla-PV-Anlage" genannt. Sie speisen den Strom direkt ins Stromnetz des Hauses bzw. der Wohnung ein, wo er dann von den angeschlossenen und eingeschalteten Elektrogeräten verbraucht wird. Wichtig ist, dass der vorhandene Stromzähler (Bezugszähler) nicht rückwärts laufen darf, falls der Eigenverbrauch zu gering ist.
Obwohl die Hersteller damit werben, dass jeder seinen eigenen Strom erzeugen kann, warnt der Verband der
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) vor den Risiken. Hier hat aber das europäische Parlament
unlängst den "Entschließungsantrag zur Strom- und Wärmeerzeugung in kleinem und kleinstem Maßstab" herausgegeben, der sich mit der
dezentralen Energiewende beschäftigt. Dieses Dokument umfasst, neben den Mini-Heizkraftwerken, auch Kleinstanlagen im Bereich
der Photovoltaik. Die EU fördert dadurch das Potential der Kleinstanlagen und hat somit ihr Potential erkannt.
|
Die Mini-PV-Anlage muss bei dem Stromlieferanten angezeigt werden. Hierbei handelt es sich um keine
Anmeldung nach dem EEG, sondern um eine Mitteilungsanzeige über den Modulbetrieb. Mieter und
Wohnungseigentümer brauchen eine Erlaubnis des Vermieters bzw. der Wohnungseigentümergemeinschaft,
um das Gerät dauerhaft anzubringen. Die Zustimmung kann mit der Begründung verweigert werden, dass die Anlage das äußere
Erscheinungsbild der Hausfassade beeinträchtigt oder/und die Beschädigung der Hauswand durch Dübel bei der
Anlagenbefestigung kann ein Grund für eine Ablehnung sein. |
Funktionsweise:
Die Miniaturanlage ist mit Solarzellen ausgestattet, die Licht in Gleichstrom verwandeln können.
Es handelt sich um die gleichen Zellen, die auch in großen Anlagen zum Einsatz kommen.
Diese werden bei den Kleinanlagen ebenfalls miteinander verbunden, um eine möglichst große Menge an Energie zu erzeugen.
Es handelt sich an dieser Stelle jedoch noch um Gleichstrom.
Der mitgelieferte Wechselrichter, welcher sich ebenfalls nur in der Größe von den gewöhnlichen PV-Anlagen unterscheidet,
wandelt diese Energie in Wechselstrom um.
Dabei wird die Frequenz, Spannung und Phase an die Netzspannung angepasst.
Über eine gewöhnliche Kabelsteckverbindung wird der Strom in die Steckdose und somit ins Hausnetz eingespeist.
Die Energie wird praktisch umgehend verbraucht. Komponenten, wie eine Kühltruhe oder der Kühlschrank, die ununterbrochen in
Betrieb sind und Strom verbrauchen, können praktisch damit betrieben werden.
Wird nun mehr Strom erzeugt, als verbraucht wird, so können Anlagen mit einem mitgelieferten Akku die Energie speichern und beispielsweise
in der Nacht oder an dunklen Tagen abgeben. Es wird daher kein erzeugter Strom verschwendet.
Die grundsätzliche Idee hinter der Technik bestand lediglich darin, die großen PV-Anlagen für den Hausgebrauch nutzbar zu machen.
Daher wurden Module und Wechselrichter einfach verkleinert. Sobald die Sonne scheint, fließt nun auch der Strom. Insbesondere Unterhaltungselektronik im Stand-by Modus und die
angesprochenen Dauerrenner (Kühlschrank, Gefriertruhe, PC, Router, Heizung, Telefon etc.) werden in ihrem Stromverbrauch entlastet.
Der Anschluss erfolgt über die herkömmliche Schutzkontakt-Steckdose (Schuko-Steckdose). Sollte der Wechselrichter nicht mit einem
230-Volt-Netz verbunden sein, so sollte er sich automatisch abschalten. Durch die eingespeiste Energie läuft der Zähler nicht rückwärts. Die meisten haben sogar
einen Rücklaufschutz. Dafür laufen die Zähler, durch den geringeren Verbrauch aus dem staatlichen Netz, langsamer!
Quelle: Web Marketing Weimar
Andreas Lange
In diesem Zusammenhang sollte man auch einmal die rechtliche Lage betrachten.
Die rechtlichen Bedenken zum Einbau eine Mini-PV-Anlage haben sich inzwischen erledigt.
Aber es gibt zu diesem Thema immer noch die unterschiedlichsten Aussagen, die von den ca. 700 Netzbetreibern in Deutschland getätigt werden.
Viele Betreiber sprechen in diesem Fall von einem kostenlosen Zähleraustausch. Dieses Argument ist verständlich, denn der Stromzähler
darf in keinem Fall rückwärts laufen. Da die ständig laufenden Elektrogeräte den erzeugten Strom sofort verbrauchen,
ist das eine vorgesehene Maßnahme, um eine Einspeisung in das öffentliche Netz zu verhindern.
Im Februar 2017 trat die DIN VDE 0100-551 "Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Andere Betriebsmittel – Abschnitt 551:
Niederspannungsstromerzeugungseinrichtungen" in Kraft. Dort sind die Anforderungen für die Einrichtung von Kleinstanlagen zur Stromerzeugung geregelt.
Daraus ergibt sich, dass Solarmodule (Komplettpakete) für die Steckdose legal sind. Dies gilt Natürlich müssen sich die
Hersteller und die Betreiber an die gesetzlichen Vorgaben halten. Beim Netzbetreiber muss die Anlage
angemeldet werden.
Nach der DIN VDE V 0100-551-1 - 2018-05 "Errichten von Niederspannungsanlagen" können die
Netzbetreiber durch das unkomplizierte Verfahren zur Anmeldung einer Mini-PV-Anlage Anmeldeformulare entwerfen.
Um die Rechtssicherheit zu festigen, wird an zwei weiteren Normen gearbeiet. Hier handelt es sich um die
DIN VDE V 0628-1 - 2018-02 "Energiesteckvorrichtungen" und eine Produktnorm, die die Anforderungen
der Plug & Play Systeme regelt. Mit der Fertigstellung wohl nicht vor 2019 zu rechnen sein.
![]() Verbraucher können Steckdosen-Solargeräte zur privaten
Stromerzeugung bis zu einer Gesamtleistung von 600 Watt jetzt selbst beim Netzbetreiber anmelden, statt wie bisher
über einen Elektroinstallateur. Rechtssicher möglich macht dies eine Neuregelung der Norm VDE-AR-N 4105, die am 27. April
2019 in Kraft tritt. Verabschiedet wurde sie in einem Normierungsverfahren vom Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN), das in Deutschland die Regeln für den
Netzanschluss von Erzeugungsanlagen erarbeitet.
Verbraucher können Steckdosen-Solargeräte zur privaten
Stromerzeugung bis zu einer Gesamtleistung von 600 Watt jetzt selbst beim Netzbetreiber anmelden, statt wie bisher
über einen Elektroinstallateur. Rechtssicher möglich macht dies eine Neuregelung der Norm VDE-AR-N 4105, die am 27. April
2019 in Kraft tritt. Verabschiedet wurde sie in einem Normierungsverfahren vom Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN), das in Deutschland die Regeln für den
Netzanschluss von Erzeugungsanlagen erarbeitet.
Stichpunkte
• Stromzähler muss Rücklaufsperre haben
• Netzbetreiber müssen Anmeldung durch Laien akzeptieren
• In Deutschland sind rund 40.000 Balkonmodule im Einsatz
Wenn der Netzbetreiber sich querstellt, dann sollten die DIN-Vorschriften angesprochen werden und
Kontakt mit dem VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.) oder der Deutschen Gesellschaft für
Sonnenenergie aufgenommen werden.
PV-Balkonmodule bis 600 Wp Leistung können jetzt direkt beim Netzbetreiber gemeldet werden
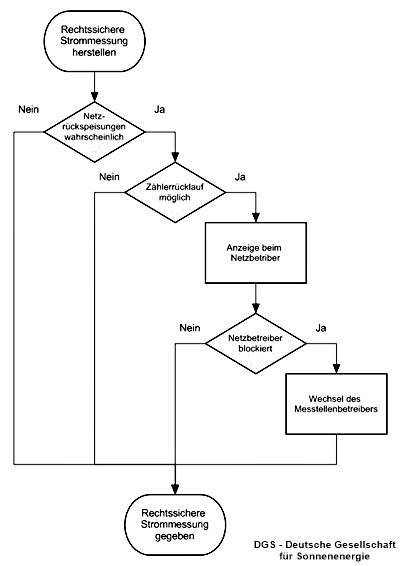
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie
Landesverband Berlin Brandenburg e.V.
Fragen und Antworten zu steckbaren
Solar-Geräten - Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie Landesverband Berlin Brandenburg e.V.
DGS veröffentlicht FAQs zu Stecker-Solar-Geräten
- pv magazine group GmbH & Co. KG
Solarstrom
direkt nutzen für Jedermann - Bosswerk GmbH & Co. KG
Solaranlagen für die Steckdose - Web Marketing Weimar / Andreas Lange
"Stecker-Solar": Solarstrom vom Balkon direkt in die Steckdose
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V.
BMWi zu "Plug-and-Play"-Photovoltaikanlagen
Das SG Ready-Label für Wärmepumpen – das sollten Sie wissen
Arne Gonschor, wegatech greenergy GmbH
Meldung von Steckdosen-Solargeräten in Deutschland
Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie
Landesverband Berlin Brandenburg e.V.
Der Begriff "Grid" (Netz) gibt an, ob eine Photovoltaik-Anlage den erzeugten Strom in das öffentliche Stromnetz einspeist (On-Grid-System) oder nur für den Eigenverbrauch genutzt (Off-Grid-System) wird.
Eine Photovoltaikanlage, die Strom in ein öffentliches Stromnetz eingespeist, wird als On-Grid-System bezeichnet. Nebem einem Solargenerator (zusammengeschaltete Module) ist ein Wechselrichter notwendig, weil in öffentlichen Stromnetzen Wechselstrom vorhanden ist.
Es gibt On-Grid Systeme, die einen Verbraucher parallel zum öffentlichen Netz zu versorgen.
Die dezentrale Solarenergie in der Nähe des Verbrauchers produziert, wodurch große Transportverluste ausgeschlossen
werden können.
Andere On-Grid-Systeme versorgen den Verbraucher alternativ zum öffentlichen Netz.
Der Verbraucher ist auch an das öffentliche Netz angeschlossen, produziert aber den Solarstrom dezentral (verbrauchsnah). Die Stromüberschüsse werden vorrangig in einem Energiespeicher gespeichert.
Dadurch wird eine höhere Versorgungssicherheit bei schwächeren Versorgungsnetzen erreicht
(Backup-System).
|
Off-Grid-Systeme werden auch in Mini-PV-Anlagen (Balkon, Hauswand, Booten, Wohnmobilen) genutzt. Ein Wechselrichter, wie er für den Netzanschluss von netzgekoppelten Photovoltaikanlagen notwendig ist, ist nur dann erforderlich, wenn die Stromverbraucher auf Wechselstrom ausgelegt sind. Bei Bedarf können sie über einen Sinus-Wechselrichter auch Verbraucher mit 230 V Wechselstrom versorgen.
Die Vorteile des Off-Grid-Systeme
• Entlegene Gebäude und Geräte können mit Energie zur Beleuchtung, zur Messung und zur Kommunikation, aber auch zum Kochen, zur Heizung oder Kühlung versorgt werden.
• Es muss kein Netz vorhanden sein bzw. keine Leitung verlegt werden.
• Es bestehen keine Zuleitungen, die anfällig wären für Schäden aufgrund von Wartungsarmut, Sabotage oder Energiediebstahl.
• Off-Grid-Systeme sind aufgrund ihrer Kompaktheit mehr oder minder rasch auf- und abbaubar; sie erhöhen die Mobilität von Versorgungseinheiten.
Die vom Netzbetreiber
abgekaufte elektrische Energie (kWh) wird vom
Bezugszähler gemessen. |
|
Elektronischer Haushaltszähler eHZ- k - Gehäuse-, Anzeige- und Bedienelemente
Quelle: EMH metering GmbH & Co. KG
Die durch den Netzbetreiber
eingekaufte bzw. die in das öffentliche Stromnetz eingespeiste
Energie (kWh) wird durch einen Einspeisezähler gemessen. Ein geeichten Einspeisezähler (Stromzähler) muss in jedes Haus, das eine an ein öffentliches Stromnetz gekoppelte Photovoltaik-Anlage hat, eingebaut werden. Dieser erfasst den von der Anlage erzeugten Strom, der vom Betreiber der Anlage an den Energieversorger abgegeben wird. Neben der Erfassung des eingespeisten Stroms (bei größeren Anlagen auch der eingespeisten Leistung durch eine Lastgangzählung) als Basis für die Abrechnung zwischen Netzbetreiber und Anlagenbetreiber, dient der Einspeisezähler auch der Überwachung der Funktions- und Leistungsfähigkeit der Photovoltaik-Anlage. Die Daten sind die Grundlage für die Einspeisevergütung, die der Betreiber vom Energieversorgungsunternehmen erhält. Der Einspeisezähler ist in der Regel vom örtlichen Netzbetreiber gegen eine jährliche Gebühr (ca. 25 bis 30 Euro) erhältlich. Bei heutigen Anlagen wird meist der vorhandene Bezugszähler durch einen Zweirichtungszähler ersetzt, der sowohl Bezug- als auch Netzeinspeisung misst. |
Wenn man für den eingespeisten Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage (PV-Anlage) erhalten möchte, dann muss ein Vertrag mit dem zuständigen Netzbetreiber abgeschlossen werden. Der Vertrag bildet die Grundlage für die PV-Abrechnung mit dem Netzbetreiber und regelt die Abnahme und Vergütung des erzeugten Solarstroms.
Eine Einspeisevergütung ist unabhängig von den Eigentumsverhältnissen an der Anlage zu zahlen. Hier kann der Betreiber auch eine andere Person als der Eigentümer sein. In der Regel ist der Eigenheimbesitzer auch der Betreiber. Die Abnahme von Solarstrom durch Netzbetreiber ist im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgelegt. Der Netzbetreiber sind gesetzlich verpflichtet, den erzeugten Solarstrom abzunehmen und zu vergüten.
Aktuelle Vergütungssätze (unter vorbehalt [andere Quellen])
Die aktuelle Höhe der Vergütungssätze ist für alle neuen Anlagen gültig, die bis zum 31. Juli 2025 in Betrieb gehen. Zum 1. Februar 2025 wurden die Vergütungssätze für Neuanlagen wieder geringfügig um 1 % abgesenkt. Unterschieden wird dabei zwischen Volleinspeise- und Eigenversorgungsanlagen.
Anlagen mit Eigenversorgung bekommen bei einer Inbetriebnahme heute folgende Vergütungssätze als feste Einspeisevergütung: Anlagen bis 10 kWp erhalten 7,94 Cent pro kWh. Ist die Anlage größer, erhält der Anlagenteil ab 10 kWp dann 6,88 Cent pro kWh.
Beispiel Eigenversorgung: Eine 15 kWp-Anlage mit Eigenversorgung erhält dann für die ersten 10 kWp 7,94 Cent und für die verbleibenden 5 kWp 6,88 Cent pro kWh, im Durchschnitt also 7,59 Cent pro Kilowattstunde.
Anlagen mit Volleinspeisung erhalten einen höheren Vergütungssatz. Für diese höhere Vergütung muss die Anlage vor Inbetriebnahme als Volleinspeise-Anlage dem zuständigen Netzbetreiber gemeldet werden.
Als feste Einspeisevergütung können Sie für die Volleinspeisung kalkulieren:
Anlagen bis 10 kWp erhalten bei Inbetriebnahme bis 31. Juli 2025 dann 12,60 Cent pro kWh. Ist die Anlage größer, erhält der Anlagenteil ab 10 kWp 10,56 Cent pro kWp.
Beispiel Volleinspeisung: Eine 15 kWp-Anlage mit Volleinspeisung erhält dann für die ersten 10 kWp 12,60 Cent, für die verbleibenden 5 kWp 10,56 Cent, also im Durchschnitt 11,92 Cent pro Kilowattstunde
EEG 2023/24: Was heute für Photovoltaik-Anlagen gilt
Verbraucherzentrale NRW e.V.
So geht's richtig! PV-Abrechnung mit dem Netzbetreiber
Leads Navigator GmbH
Viele Betreiber von Photovoltaikanlagen stehen immer wieder vor dem Problem, dass auf dem Zweirichtungszähler ihrer Anlage auf der Bezugsseite entweder ein Verbrauch von nur wenigen Kilowattstunden seit Inbetriebnahme angezeigt (Geringverbrauch), oder der Zähler bewegt sich gar nicht (Nullverbrauch). Umso unerfreulicher ist dann die Überraschung, wenn der zuständige Grundversorger den Anlagenbetreiber als Kunden "in der Grundversorgung" begrüßt, über die allgemeinen Preise und Bedingungen informiert und die ersten Abschlagszahlungen geltend macht. Diese summieren sich nicht selten bis auf gut 100 € im Jahr. Selbst bei einem Wechsel zu einem Stromanbieter mit sehr geringen Grundgebühren kommt der Anlagenbesitzer kaum unter 40 € im Jahr – über die übliche Laufzeit einer EE-Anlage sind das 800 €.
Nullverbrauch
Diese Forderungen sind jedenfalls dann unberechtigt, wenn die Anlage gar keinen Strom verbraucht. Denn die tatsächliche Stromentnahme ist die Willenserklärung, anhand derer das Gesetz einen Vertragsschluss begründen will. Ohne diese Stromentnahme kommt der Grundversorgungsvertrag nicht zustande, und in dem Fall stehen dem Grundversorger auch keine Zahlungsansprüche zu. Dies haben verschiedene Gerichte sowie die Clearingstelle EEG bestätigt. In diesem Fall sollten Sie nicht an den Grundversorger zahlen.
Sie sollten die Forderungen aber auch nicht unwidersprochen lassen, um nicht Gefahr zu laufen, dass die Ansprüche als anerkannt behandelt werden. Dies kann dazu führen, dass der Energieversorger mit Sperrung des Anschlusses droht. Mit dem beigefügten Musterschreiben A können Sie die Ansprüche einfach und unkompliziert zurückweisen.
Geringverbrauch
Rechtslage
Komplexer und leider ungünstiger für den Anlagenbetreiber ist die Rechtslage bei einem zwar nur geringen, aber nachgewiesenen, d. h. am Zähler ablesbaren Strombezug der Anlage.
Der Gesetzgeber hat Ausnahmen für solche Fälle nicht vorgesehen: Die Betreiber von EE-Anlagen werden – trotz ihrer Rolle als Einspeiser, die eine völlig andere ist – genau so behandelt wie jeder andere Letztverbraucher, der Strom aus dem Netz entnimmt. Kann diese Stromentnahme nicht einem bestehenden Lieferverhältnis zugeordnet werden, tritt der Grundversorger auf den Plan. Ihm werden die Stromentnahmen zugewiesen und er macht auf dieser Grundlage Ansprüche nach den Allgemeinen Preisen und Bedingungen geltend.
Auch in diesen allgemeinen Belieferungsbedingungen gibt es weder Regelungen für Einspeiseanlagen noch eine Bagatellgrenze, bis zu der eine vergünstige Abrechnung möglich ist. Die Diskussion mit dem Grundversorger hierüber ist meist fruchtlos, weil auf Erwiderungen im Regelfall mit standardisierten Schreiben und immer weiteren Mahnungen reagiert wird.
Wir halten dieses undifferenzierte Vorgehen für grob falsch und haben daher im Rahmen des Solidarfonds Nullverbrauch eine Musterklage gegen einen Grundversorger angestrengt. Leider haben weder das Amts- noch das Landgericht diesen Besonderheiten Rechnung getragen und bei der Klage wie auch bei der Berufung nicht im Sinne der Anlagenbetreiber entschieden. Da der Weg zum Bundesgerichtshof nicht offensteht, ist auf absehbare Zeit nicht damit zu rechnen, dass Anlagenbetreiber sich erfolgreich gerichtlich gegen diese Ansprüche zur Wehr setzen können.
Falls Sie in solchen Fällen also nicht zahlen, müssen Sie im Falle einer Klageerhebung damit rechnen, dass Sie zur Zahlung verurteilt werden. Falls Sie sich entscheiden, zu zahlen, empfehlen wir Ihnen, die Zahlung unter Vorbehalt zu leisten. Auf diesem Wege halten Sie sich zumindest die Möglichkeit offen, im Falle einer positiven gerichtlichen Entscheidung die Zahlungen zurück zu fordern. Dies können Sie dem Grundversorger mitteilen, indem Sie das beigefügte Musterschreiben B verwenden.
Quelle: Peter Nümann und Christina Wohlgemuth, NÜMANN + SIEBERT Rechtsanwälte PartGmbB
Unzulässige Abrechnung von Nullverbrauch und Marginalverbrauch
bei PV-Anlagen
Peter Nümann und Christina Wohlgemuth, NÜMANN + SIEBERT Rechtsanwälte PartGmbB
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV)
Musterschreiben A und Musterschreiben B
Peter Nümann und Christina Wohlgemuth, NÜMANN + SIEBERT Rechtsanwälte PartGmbB
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV)
Trotz Nullverbrauch in der Grundversorgung?
NÜMANN + SIEBERT Rechtsanwälte PartGmbB
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.
Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.
Die von einer Photovoltaikanlage
erzeugte Energie wird mit einem Ertragszähler
(Produktionszähler, Solarzähler)
gemessen und ist bei der Eigenverbrauchsvergütung
notwendig. Im Gegensatz zum Einspeisezähler misst der Ertragszähler
den gesamten von der Photovoltaikanlage produzierten Strom und
nicht nur den Anteil misst, der in das öffentliche Netz gespeist
wird. Dadurch kann der Anteil an selbst verbrauchtem Solarstrom
nachwiesen werden. Er hat normalerweise eine Rücklaufsperre,
um den (geringen) Eigenverbrauch des
Wechselrichters in Zeiten ohne Produktion nicht zu berücksichtigen.
Der Ertragszähler verbleibt immer im Eigentum
des Anlagenbetreibers. Zunehmend werden die Einspeise- und Bezugszähler durch einen Zweirichtungszähler ersetzt. Ein Nachteil ist, dass dieser Zähler nur durch den Netzbetreiber gestellt werden darf, da er die Hoheit über den Zähler für den aus dem Netz bezogenen Strom besitzt. |
Wenn ein Balkonkraftwerk bzw. eine Mini-PV-Anlage normal funktioniert, dann ist eine Einspeisemessung nicht notwendig. Man kann die Verteilung des eingespeisten Stroms sowieso nicht beeinflussen. Wenn die Einspeisung über den Verbrauch des Hausnetzes liegt, dann freut sich der Stromversorger über die "Spende". |
| Die elektrische
Energie kann in das öffentliche
oder/und häusliche Netz eingespeist werden.
Die Wärme aus der Solarflüssigkeit
kann direkt in die Trinkwassererwärmung
oder über einen Pufferspeicher für die jeweilige Verwendung
(Trinkwassererwärmung, Heizung ) zwischengespeichert werden. |
| Ein überschüssiger Ertrag einer thermischen Solaranlage kann nicht über lange Zeit gespeichert werden, weil der Speicher meistens nicht groß genug ist bzw. die Wärme nicht verbraucht werden kann. Im Gegensatz dazu kann der überschüssige Ertrag einer Photovoltaikanlage direkt ins Stromnetz eingespeist werden und mit der Einspeisevergütung kann ein Gewinn erzielt werden. Ein Nachführsystem
ist ein Metallgestell, welches mithilfe eines
Elektromotors und einer Steuerung
über ein oder zwei Achsen
schwenkbar ist. Solar
Tracking - DEGERenergie
GmbH& Co. KG
|
MPPT-Funktion
Die MPPT-Funktion (Maximum Power Point Tracking >
Maximal-Leistungspunkt-Suche) eines Reglers ermöglicht
einen maximalen Ertrag einer Photovoltaikanlage.
Das System wird für alle Systeme eingesetzt, deren Leistungs-Ausgang
nicht konstant bleibt. Ein MPPT-System funktioniert folgendermaßen:
1. Speichern der aktuellen Leistung.
2. Ändern der Steuergröße.
3. Einen Moment warten.
4. Vergleich der aktuellen Leistung mit der vorhergehenden Leistung. Wenn
sie größer ist, Speicherung der Leistung.
5. Korrektur oder Änderung der Steuergröße.
6. Wiederholung von Punkt 3 an.
Das MPPT-Verfahren erlaubt Energie zu sparen und Zeit zu gewinnen. Energie zu sparen,
weil die Verluste verringert werden. Und Zeit, weil die Aufladung schneller
abläuft. Quelle: Diplomarbeit
2010 - Lucien Roten - Stromversorgung für einen drathlosen Sensor
Der Maximal-Leistungspunkt (Maximum Power Point) ändert
sich somit ständig, da er von der Sonneneinstrahlung (und Beschattung), der Temperatur und den Moduleigenschaften abhängig ist. Ein MPP-Tracker im Wechselrichter sorgt ständig dafür, dass die Leistung der zu Strings zusammengefassten
Module, immer optimal auf den jeweiligen Strahlungs- und Temperaturzustand
abgestimmt ist. Es gibt auch Wechselrichter für
Photovoltaikanlagen, die teilweise verschattet sind,
bei denen die MPP-Tracker auf Verschattungssituationen hin optimiert sind.
Funktion der MPP Regelung eines Photovoltaikwechselrichters- Matthias Diehl
|
Die von den Solarmodulen gewonnene Energie
wird bis zu 99 % über eine Regelung direkt mit dem Heizstab
in nutzbare Wärme umgewandelt. Die MPPT-Funktion
des Reglers (Maximum Power Point Tracking > Maximal-Leistungspunkt-Suche)
sorgt dabei für einen maximalen Solarertrag. Die Energieübertragung
von den Photovoltaikmodulen erfolgt über zwei normale 4 mm²
Solarkabel mit wenigen Millimetern Durchmesser.
Photovoltaik Trinkwasser Regelung PVH C-1.05 |
Solarkraftwerke
Die Stromerzeugung durch die Sonne
unterscheidet zwischen der direkten (Photovoltaik-Technologie)
und der indirekten (thermische
bzw. solarthermisches Kraftwerk) Nutzung
der Sonnenenergie. Bei der Photovoltaik-Technologie
wird das Sonnenlicht direkt in den Solarzellen in Strom
umgesetzt. In den solarthermischen Kraftwerken wird die
Wärme der Sonne über Absorber
als primäre Energiequelle verwendet.
Photovoltaik-Technologie
Eine Photovoltaikanlage besteht aus vielen
miteinander verkoppelten Solarzellen. Über Halbleiterschichten wird in den Solarzellen Sonnenlicht in
elektrischen Strom umgewandelt. Eine Neuheit ist die CPV-Technologie (Concentrated Photovoltaics).
Ein
Bürgersolarpark (Photovoltaik-Freiflächenanlagen)
fördert die Akzeptanz für Photovoltaikanlagen. Warum muss man auf jedes Haus eine eigene Anlage
packen? Sinnvoller ist es, in einer Gemeinde bzw. Stadt eine große Solaranlage zu bauen. Hier kann sich jeder Bürger
beteiligen, vor allen Dingen dann, wenn er kein geeignetes Dach zur Verfügung hat oder sich das Dach nicht
verschandeln oder den Anblick den Nachbarn die spiegelnden Flächen nicht zumuten will. Die Nachteile einer PV-Anlage
bezüglich des Brandschutzes (Blitzschutzanlage) oder bei einem
Feuer (Brandlöschung)
sind zunehmend in der Diskussion.
Für Wind- und Solarparks sollen die Betreibergesellschaften künftig nach
dem Gewerbesteuergesetz § 29 mindestens
90 %, statt bislang 70 % der Gewerbesteuer an die Standortkommunen zahlen. Dadurch wird u. a. eine
bessere Akzeptanz der Anlagen vor Ort erhofft.
|
| |
|
Photovoltaik Freiflächenanlagen - Photovoltaik.org
Kritisch für den Naturschutz? Freiflächenphotovoltaik: Grundlagen und Anforderungen
- NABU Schleswig-Holstein
Großer Erfolg der EEG-Novelle: Dauerhaft sichere Einnahmen für die Gemeinden
- Karl-Heinz Remmers, pv magazine group GmbH & Co. KG
Genossenschaften - Erneuerbare Energien
- DGRV - Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V.
Wir zapfen die Sonne an - Deutsche Bahn
Gute Planung von PV-Freilandanlagen
- Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V.
Habeck plant zeitnahe Klima-Sofortmaßnahmen
Agri-Photovoltaik
Mit dem Agri-Photovoltaik-Verfahren wird ein Landwirt auch zum Ernergiewirt. Die landwirtschaftlichen Flächen werden zum Anbau von Getreide, Obst und Gemüse (Photosynthese), zur Weidewirtschaft (Schaf, Ziege, Rind) und gleichzeitig zur PV-Stromproduktion (Photovoltaik) genutzt.
In Deutschland steckt die Agri-Photovoltaik noch in den Kinderschuhen. Das soll sich ab 2023 ändern. Denn um Flächen besser für den Ausbau erneuerbarer Energien nutzen zu können, wird die Förderung der Agri-PV mit der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2023) ermöglicht.
Um Solarstrom und Lebensmittel auf derselben Fläche zu erzeugen, ist ein ausgewogenes Verhältnis von Licht und Schatten erforderlich. Das Fraunhofer ISE hat Modelle und Konzepte entwickelt, um die Erträge in Form von Energiegewinnung und landwirtschaftlichen Produkten durch gezieltes Lichtmanagement zu optimieren.
|
|
|
|
|
|
Agri-PV-Plattform |
Energiegenossenschaft / Klimaschutzgenossenschaft
Das Ziel einer Energiegenossenschaft ist, dass Bürgerinnen und Bürger dezentral in erneuerbare Energien (z. B. Windkraftanlagen, Photovoltaik-Freilandflächen, Biogasanlagen, Blockheizkraftwerke, Wasserkraftwerke) investieren. So sollen Arbeitsplätze in der Region gehalten bzw. geschaffen werden und die Erträge und Gewerbesteuern der
Kommune zugutekommen. Außerdem hat sich bestätigt, dass eine bessere Akzeptanz der Anlagen vor Ort gegeben ist.
Die Gründungsvoraussetzungen gleichen den der Eingetragenen
Genossenschaft (eG)
In Energiegenossenschaften kommen unternehmerisches Engagement und Maßnahmen
zum Umwelt- und Klimaschutz zusammen. Die lokale Verankerung und das ehrenamtliche
Engagements der aktiven Mitglieder sind das Kennzeichen und der Vorteil der Energiegenossenschaften und wenn sie weitere klimaschutzrelevante
Geschäftsfelder erschließen und ihre Mitglieder sowie die Öffentlichkeit für konkrete Klimaschutzmaßnahmen* gewinnen, dann kann man diese auch als Klimaschutzgenossenschaft bezeichnen.
* Um bis 2050 die festgelegten deutschen Klimaziele zu erreichen, müsen
die Treibhausgasemissionen um 80 bis 95 % gegenüber 1990 verringert werden. Dazu sind grundlegende Umstellungen in allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen vorzunehmen. Dies muss nicht unbedingt zu starken Einschränkungen führen.
Notwendige Veränderungen in folgenden Lebens- und Wirtschaftsbereichen:
- Wohnen (Wärmedämmung, Passivhausstandard, weniger und effizientere Haushaltsgeräte, energiesparende Beleuchtung)
- Heizen, Kühlen, Lüften (Wärmepumpen, BHKW, Brennstoffzellen, Wasserstoffnutzung, synthetisches Methan und Erdgas, Kontrollierte Wohnungslüftung)
- Landwirtschaft (Senkung der Stickstoffüberschüsse, Minderung der Ammoniakemissionen, Verminderung der Lachgasemissionen, Wiedervernässung von Mooren, Anhebung des Humusgehalts, Senkung der Tierzahlen [Methan-Emissionen senken])
- Ernährung (weniger Fleischkonsum, sorgsamerer Umgang mit Lebensmitteln)
- Mobilität (Fahrräder, E-Bikes, E-Lastenfahrräder, E-Autos, Bus, Bahn, CarSharing, kürzere Wegstrecken)
- Energieversorgung (Solarthermie [Photovoltaikanlage, Solarthermie, solare Fernwärme, Sonnenwärmekraftwerk, Aufwindkraftwerk], Windenergie [Windkraftanlage, Flugwindkraftwerk], Bioenergie (Biomasse, biogener Brennstoff und Biokraftstoff], Geothermie [Erdwärme, Tiefenwärme])
Geschäftsbereiche der Energiegenossenschaften
- Energieerzeugung
- Vertrieb alternativer Energie (Strom, Wärme, Gas)
- Übernahme und Betreiben von Versorgungsnetzen
- Dienstleistungen für einen effizienteren Umgang mit Energie und Klimaschutz (Beratung, Energiespar-Contracting)
Vorteile einer Energiegenossenschaft
- Die Genossenschaft ist den Mitgliedern verpflichtet und dient nicht vordergründig finanziellen Interessen
- Wirtschaftliche Beteiligung der Mitglieder (Mitglied ist Träger und Nutzer der Leistungen)
- Kein Mindestkapital zur Gründung erforderlich
- Flexible und schnelle Entscheidungsfindungen
- Insolvenzsichere Gesellschaftsform – überörtliche Prüfung durch Genossenschaftsverband
- Demokratische Rechtsform – jedes Mitglied hat eine Stimme
- Nicht aufkaufbar – keine "feindliche Übernahme" möglich, wie es bei Kapitalgesellschaften möglich ist
- Ein- und Austritt durch eine einfache Willenserklärung – es ist kein Notar und kein Gericht nötig – so entstehen keine Kosten!
Energiegenossenschaften
Bürger, Kommunen und lokale Wirtschaftin guter Gesellschaft
- Agentur für Erneuerbare Energien e.V.
In sieben Schritten zur Energiegenossenschaft - Netzwerk Energiewende jetzt e.V.
Energiegenossenschafften im Auf- und Abschwung
- Agentur für Erneuerbare Energien e.V.
Maßnahmen zum Klimaschutz: So erreichen wir die Klimaziele bis 2050
- Öko-Institut e.V.
Klimaverträglich leben im Jahr 2050 + Klimaschutzszenario 2050 - 2. Endbericht
- Öko-Institut e.V.
Genossenschaften - Erneuerbare Energien
- DGRV - Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V.
Bei der CPV-Technologie (konzentrierte Photovoltaik) wird das Sonnenlicht mittels optischer Linsen oder gebogenen Spiegeln konzentriert bzw. gebündelt, ehe es auf den Halbleiter in der Solarzelle trifft. So kann der Wirkungsgrad eines Photovoltaikmoduls auf ca. 44 % gesteigert werden.
|
|
Ein Sonnenkollektor
fängt Sonnenlicht auf einer relativ großen
Fläche ein und konzentriert es auf
eine deutlich kleinere Fläche. Die Heizleistung
auf der kleinen Fläche wächst proportional zum Größenverhältnis
dieser beiden Flächen. Bei der konzentrierten Photovoltaik
wächst die erzeugte Strommenge hingegen überproportional
zur Intensität des eingestrahlten Sonnenlichts. Wird also beispielsweise
das auf einen Quadratmeter einfallende Licht auf eine Solarzelle
mit deutlich kleinerer Fläche konzentriert, wird mehr Strom
erzeugt als durch eine herkömmliche Solarzelle von einem Quadratmeter
Größe. |
Nachteile
sind die hohe Abhängigkeit von der Lichtbündelung,
dass eine direkte Sonneneinstrahlung erforderlich macht,
mit diffusem Streulicht bei bewölktem Himmel
arbeitet die konzentrierte Photovoltaik sehr schlecht.
Hier schneiden die Hochleistungsmodule schlechter ab als herkömmliche
Solarzellen. Außerdem müssen CPV-Module permanent
und exakt der Sonne
nachgeführt werden.
Durch die starke Aufheizung der Module
ist diese Technologie für kleine Photovoltaikanlagen auf dem Dach
ist diese Technologie zur Zeit nicht geeignet, da ein ständiges
Abführen der Wärme, oft mit einer
aktive Kühlung, notwendig ist. Deswegen ist die
konzentrierte Photovoltaik nur für großflächige
Freilandanlagen in Regionen ("Sonnengürtel"
der Erde; z. B. Südspanien, Südfrankreich,
Griechenland, Süditalien, MENA-Region [Middle East & North Africa])
mit vielen Sonnenstunden umzusetzen.
Die Turbozelle - Heise Medien
Solarthermische
Kraftwerke - Thermische Solarkraftwerke
Alle Kraftwerkstypen werden auf Freiflächen
installiert und benötigen einen sehr großen Platzbedarf
(Ausnahme; Parabolspiegel-Kraftwerke). Ein solarthermisches Kraftwerk
(thermisches Solarkraftwerk) erzeugt mit Sonnenenergie
zunächst Wärme, dann mit einer Dampfturbinenanlage
mechanische Energie und schließlich in einem Generator
elektrische Energie.
Daneben gibt es eine Krafwerksart (Aufwindkraftwerk),
das mit Hilfe eines Luftstroms eine Turbine
mit Generator antreibt.
Viele Organisationen bzw.
Institute (FVEE
- ForschungsVerbund Erneuerbare Energien) befassen sich mit der Förderung
und Erstellung von solarthermischen Kraftwerken. So hat
sich z. B. die Initiative
Desertec bislang auf Europa und der
MENA-Region (Middle East & North
Africa) konzentriert und plant eine globale Kampagne zum Bau von solarthermischen
Anlagen. Aufgrund der politisch unsicheren Situation
in der MENA-Region bestehen hier nur Planungen und die
Ausführungen sind auch Eis gelegt. Ein Fünftel
des weltweit benötigten Stroms könnte bis 2050
aus großen Sonnenkraftwerken stammen.
Die solarthermischen
Kraftwerke werden in 2 Gruppen untergliedert.
• CSP-Technologie (Concentrated Solar Power)
- Parabolrinnen-Kraftwerk
- Parabolspiegel-Kraftwerk (Dish-Stirling-Kraftwerk)
- Solarturm-Kraftwerk
- Sonnenöfen
• Aufwindkraftwerk
In
der CSP-Technologie (Concentrated
Solar Power) wird über
Parabolrinnen, Parabolspiegel oder Heliostate
die Lichteinstrahlung auf einen Absorber gebündelt,
in dem extrem hohe Temperaturen entstehen. Die Wärme
wird in einem nachgeschalteten Wärmekraftwerk in
elektrischen Strom umgewandelt. Hier ist die Stromerzeugung
von der Intensität des eingestrahlten Sonnenlichts
bzw. der direkten Sonnenstrahlung abhängig. Im Gegensatz
zur "normalen" Photovoltaik, die auch an Wolken
gestreute Sonnenlicht direkt in Strom umgewandeln kann,
benötigt die CSP-Technologie einen Himmel,
der die meiste Zeit wolkenlos ist. Deswegen sollte der
Standort eine hohe direkte Sonneneinstrahlung von über
2.000 kWh/m²a anbieten, was durch eine äquatornahe
Lage und einen ständig geringen Bewölkungsgrad
erreicht wird. Dies ist in Europa nur in Südspanien,
Süditalien und Griechenland ökonomisch möglich.
Ideale Standorte wären
die Wüstenregionen z. B. in der MENA-Region
(Middle East & North Africa). Der erzeugte Strom müsste über
mehrere tausende Kilometer mit Hochspannungs-Gleichstromleitungen
(HVDC) transportiert werden, was technisch möglich
wäre, aber aufgrund der politisch unsicheren Situation
bestehen hier nur Planungen und die Ausführungen sind auch Eis gelegt.
Konzentrierte
Solarthermie (CSP) - Christoph Schünemann / regenerative-zukunft.de
Konzentrierte
solarthermische Energie: enorme Potenziale in der MENA-Region
- Heindl Server GmbH
Konzentriertes
Sonnenlicht zur Energieerzeugung nutzen
- BINE Informationsdiens
CSP-Anlagen:
Hoffnungsträger mit Schattenseiten - VDI Verlag
GmbH
|
Prototyp
für ein Aufwindkraftwerk in |
Das Aufwindkraftwerk ist ein solarthermisches Kraftwerk, das für einen Standort mit hoher direkter Sonneneinstrahlung geeignet ist. Ideal sind eine äquatornahe Lagen (Wüstenregionen z. B. in der MENA-Region (Middle East & North Africa) und/oder Gegenden mit einem ständig geringen Bewölkungsgrad. Diese sind in Europa in Südspanien, Süditalien und Griechenland vorhanden. Aufwindkraftwerke - Jörg Schlaich - SBP Sonne GmbH
|
Die Luft
unter einem großen transluzenten Kollektordach
durch die Sonne erwärmt. Durch den Dichteunterschied
zwischen der warmen Luft im Kollektor
und der kälteren Luft im Außenbereich
strömt die Luft radial einer in der Mitte des Kollektors angeordneten,
vertikalen, unten offenen Röhre zu und steigt in
dieser auf. Eine am Fuß der Röhre eingebaute Turbine
mit Generator wird durch die Luftströmung
angetrieben und dadurch Strom erzeugt.
Ein kontinuierlicher 24-Stunden-Betrieb
wird durch im Kollektor ausgelegte geschlossene Wasserschläuche
garantiert. Sie geben ihre tagsüber gespeicherte Wärme
in der Nacht wieder ab. Hier gibt es außer der
einmaligen Befüllung der Schläuche keinen Wasserbedarf.
|
|
|
|
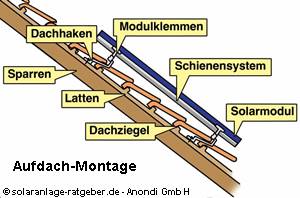
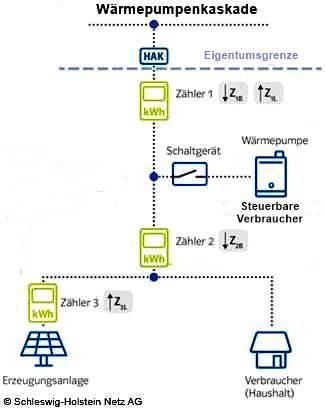

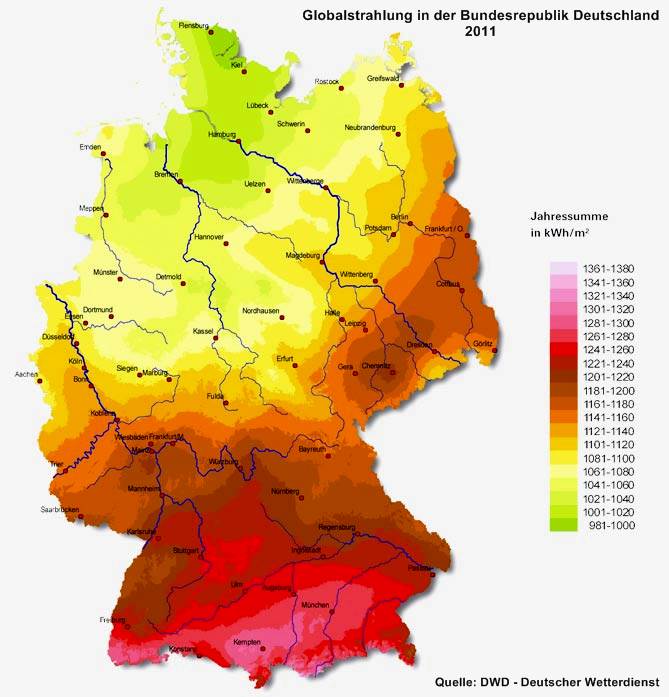
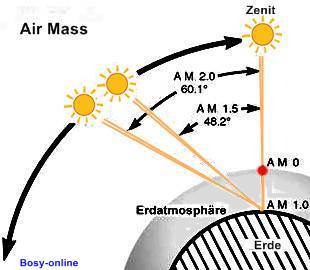

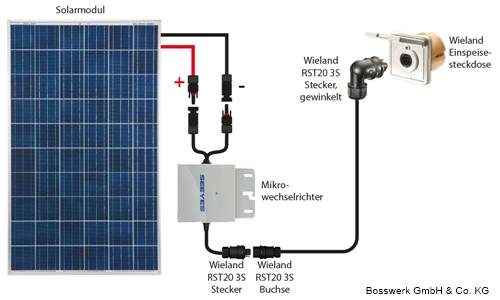
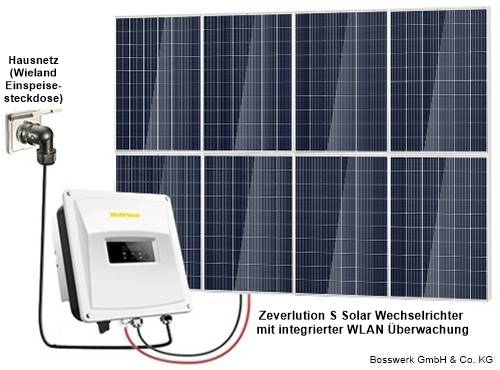
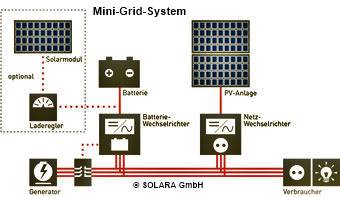


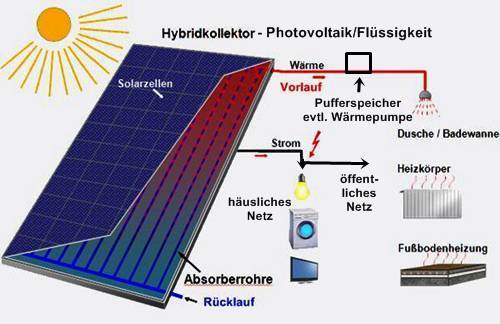





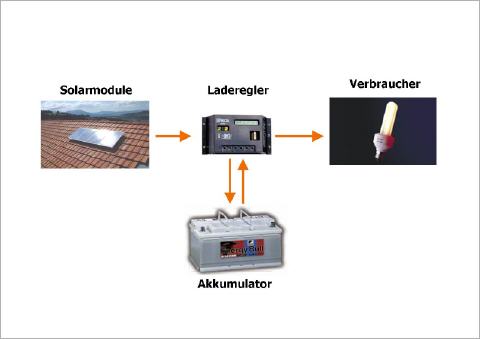
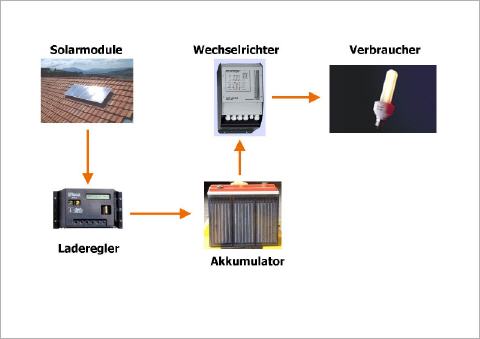
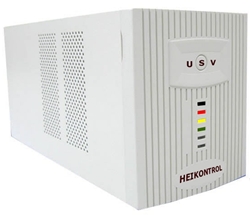

 ....
....