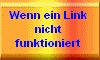Brandschutz Geschichte der Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Solartechnik |
Grundlage für den Brandschutz ist die Musterbauordnung (MBO 2002), die aber in den Bauordnungen der Bundesländer verschieden umgesetzt wurde. Die aufgeführten DIN-Normen (z. B. DIN 4102 - Brandschutz im Hochbau, DIN EN 13501 - Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten) sind nur Mindestanforderungen und nur Empfehlungen sind. Der Planer und die ausführenden Firmen sind für das richtige Brandschutzkonzept verantwortlich.
Der Brandschutz in Deutschland ist rechtlich gesehen Ländersache, daher gibt es 16 Brandschutzgesetze. Jedes Bundesland hat sein eigenes Brandschutzgesetz.
Der Brandschutz umfasst Maßnahmen
-
die ein Entstehen eines Brandes verhindern
-
die eine Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorbeugen
-
die bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren ermöglichen
-
die wirksame Löscharbeiten ermöglichen
Für jedes größere Wohnungs- oder Industriegebäude muss in Deutschland ein Brandschutzgutachten durch einen zugelassen Brandschutzgutachter bzw. -sachverständiger erstellt werden.
Baulicher Brandschutz
Schon bei der architektonischen Planung eines Gebäudes müssen Brandschutzmaßnahmen berücksichtigt werden. Ein Brandschutzkonzept wird Brand- und Rauchabschnitte festlegen. Auch die Sicherung der Flucht- und Rettungswege sind Grundlage dieser Planung.
- Planung von Brand- bzw. Rauchabschnitten
- Brandwände
- Brandschutztüren
- Selbstschließende Türen
- Fluchtwege
- Brandschutzbeschichtung/ Brandschutzanstrich
- Sicherung der Flucht- und Rettungswege
- Sprinkleranlagen
- Rauchmelder
- Notbeleuchtung
- Brandmeldeanlagen
- Feuerwehrzufahrten
- Brennbarkeit von Baustoffen
- Widerstandskraft von Baustoffen
- Löschwasserentnahmestellen
- Vorkehrungen treffen, die eine Entstehung von Bränden und eine Gefährdung von Leben und Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch Brände verhindern
- Feuerlöscheinrichtungen und Brandmelder vorsehen
- Maßnahmen treffen, die eine Brandbekämpfung und Evakuierung im Brandfall möglich machen
- Personen (z. B. Brandschutzbeauftragter) bestellen, die für die Brandbekämpfung und Evakuierung zuständig sind
- Arbeitnehmer/-innen in der Handhabung der Löschgeräte schulen.
- Arbeitsstätten evtl. mit einer Blitzschutzanlage ausstatten
Organisatorischer Brandschutz
Zu einem richtigen Brandschutzkonzept gehören auch organisatorische Maßnahmen. Diese sollen folgendes beinhalten:
- Verhütung der Entstehung von Bränden und Explosionen, z. B. durch die Verringerung bzw. Beseitigung von Brandlasten, Maßnahmen gegen Brandstiftung, zeitlich und örtlich begrenzte Nutzungsbeschränkungen, Erlaubnisschein für Heißarbeiten (z. B. Schweißen, Löten)
- Begrenzung von Brandschäden, z. B. durch Freihaltung und Sicherstellung der Begehbarkeit der Rettungswege und der Flächen für die Feuerwehr, Planungen für den Gefahrfall hinsichtlich der Bekämpfung von Entstehungsbränden und der Organisation und Unterstützung von Evakuierungsmaßnahmen, Beseitigung von gewaltsam offengehaltener Feuerschutzabschlüsse
- Sicherstellung der Wirksamkeit der baulichen und technischen Brandschutzmaßnahmen: z. B. Instandhaltung von brandschutztechnischen Einrichtungen wie Feuerschutzabschlüssen und rauchdichten Türen, Brandschutz bei baulichen Änderungen und Nutzungsänderungen, organisatorische Überwachung der Betriebsbereitschaft und Funktionsfähigkeit anlagentechnischer Brandschutzmaßnahmen wie Brand-/Rauchmelder, Alarmierungseinrichtungen
- Schulung der Beschäftigten im brandschutzgerechten Verhalten, z. B. durch Unterweisungen in der Bedienung von Feuerlöschern, Unterweisungen über die Brandschutzordnung, Feueralarmübungen
Der anlagentechnische Brandschutz ist eine Ergänzung zum baulichen Brandschutz. Dabei müssen die verschiedenen Brandschutzsysteme auf einander abgestimmt werden. Dazu gehören:
- Brandmeldeanlagen nach DIN 14 675
- natürliche und maschinelle Rauchabzugsanlagen nach DIN 18 232
- Feuerlöschanlagen (z. B. Sprinkleranlagen)
- Anlagen zur Löschwasserbevorratung und -versorgung
- Rauch- und Wärmeabzuganlagen
Um die Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorzubeugen wird ein Gebäude in Brandabschnitte unterteilt. Dieses sind Bereiche zwischen Brandwänden und -decken, die der Ausbreitung von Bränden für eine in der Bauordnung festgelegten Zeit widerstehen können.
Die Brandabschottungen oder Trennungen von Brandabschnitten sind brandschutztechnische Bauteile (Wände und Decken). Die Lage und der Abstand der Abschottungen ergibt sich aus zahlenmäßigen Festlegungen (z. B. Abstand von Brandwänden max. 40 m), aus nutzungsspezifischen Festlegungen (z. B. Abschottung von Bereichen, die durch Löschanlagen geschützt werden, Trennwände zwischen verschiedenen Nutzungseinheiten bzw. ungeschützten Bereichen oder zwischen Nutzungseinheiten und Fluchtwegen).
Die brandschutztechnischen Bauteile (Trennwände, Brandwände und Decken) und Abschlüsse von Öffnungen (Brandschutztüren, Brandschotts oder Brandschutzklappen) sind in der Musterbauordnung (MBO 2002) aufgeführt. Hier ist auch die Widerstandsfähigkeit gegen Feuer, ihrer Brennbarkeit oder ihrer Standfestigkeit nach einer bestimmten Einwirkungsdauer von Feuer (z. B. Brandschott) den Klassifizierungen der DIN 4102 oder Zertifikaten (Prüfzeugnisse oder Zulassungen) festgelegt.
Aber auch durch die Einhaltung bestimmter Abstände von Gebäuden oder Nutzungsbereichen können Brandabschnitte eingerichtet werden. So kann z. B. eine Ausbreitung von Feuer durch einen Abstand von 2,50 m von der Grundstücksgrenze bzw. 5 m vom nächsten Gebäude vorgebeugt werden.
Durch den Einbau von Brandmeldeanlagen oder automatischer Feuerlöschanlagen können auch größere Brandabschnitte in Sonderbauten (Industriebau, Verkaufsstätten, Garagen) festgelegt werden.
Die Personensicherheit steht bei der Planung eines Gebäudes an oberster Stelle. Fluchtwege* und Rettungswege* müssen daher von Beginn an berücksichtigt werden. Dabei sind neben den baulichen Anforderungen auch gesetzliche Vorschriften zu beachten. Jedes Gebäude sollte über ein maßgeschneidertes Sicherheitskonzept mit optimaler Fluchtwegsicherung verfügen. Dazu gehören Brand- und Gefahrenmeldeanlagen, Zutrittskontrollsysteme in Kombination mit einer Türzentrale und einem Türschließsystem, Fluchttürverriegelungen oder Motorschlösser sind nur einige der möglichen Varianten. Eine frühzeitige Planung und Türfestlegung im Gebäude ist auch wichtig, um spätere Anpassungen und Nachrüstungen vorbereiten zu können.
* Fluchtwege sind Verkehrswege, an die besondere Anforderungen gestellt werden und die der Flucht aus einem möglichen Gefährdungsbereich dienen. Fluchtwege und Notausgänge führen auf möglichst kurzem Weg ins Freie oder in gesicherte Bereiche - zum Beispiel anderer Brandabschnitt. Fluchtwege im Sinne der ASR A2.3 sind auch die im Bauordnungsrecht definierten Rettungswege, sofern sie selbstständig begangen werden können.
* Rettungswege sind die wichtigsten und baurechtlich unbedingt notwendigen Teile des Gebäudes, über die Personen das Gebäude selbst verlassen oder über die sie gerettet werden können und sind die Angriffswege der Feuerwehr. Grundsätzlich sind alle Wege, die für die Erschließung bzw. Nutzung des Gebäudes erforderlich sind, i.d.R. auch Rettungswege Rettungswege dienen in erster Linie der Flucht und sind dann Fluchtwege. Ist diese (selbstständiges Verlassen des Gefahrenbereichs) nicht bzw. wegen Feuer und Rauch nicht mehr möglich, dienen Rettungswege zur Rettung von Menschen und Tieren durch die Rettungskräfte (gerettet werden).
|
|
|
|
Für die barrierefreie Gestaltung der Fluchtwege und Notausgänge sowie der Flucht- und Rettungspläne gilt die ASR V3a.2 "Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten", Anhang A2.3: Ergänzende Anforderungen zur ASR A2.3.
Erster Fluchtweg
Den ersten Fluchtweg bilden die für die Flucht erforderlichen Verkehrswege und Türen, die nach dem Bauordnungsrecht notwendigen Flure und Treppenräume für notwendige Treppen sowie die Notausgänge.
Zweiter Fluchtweg |
Ein Notausstieg ist im Verlauf eines zweiten Fluchtweges ein zur Flucht aus einem Raum oder einem Gebäude geeigneter Ausstieg.
Notausgänge
Ein Notausgang ist ein Ausgang im Verlauf eines Fluchtweges, der direkt ins Freie oder in einen gesicherten Bereich führt.
Ein gesicherter Bereich (z. B. benachbarte Brandabschnitte) ist ein Bereich, in dem Menschen vorübergehend vor einer unmittelbaren Gefahr für Leben und Gesundheit geschützt sind.
Anforderungen
• Fluchtwege sind deutlich erkennbar und dauerhaft zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung ist im Verlauf des Fluchtweges mit Richtungsangabe gut sichtbar anzubringen.
• Die Fluchtwegkennzeichnung besteht je nach Gefährdung, z. B. aus einer Beschilderung mit Sicherheitszeichen, Sicherheitsbeleuchtung oder einem optischen Sicherheitsleitsystem.
• Fluchtwege sind mit einer Sicherheitsbeleuchtung auszurüsten, wenn bei Ausfall der allgemeinen Beleuchtung das gefahrlose Verlassen der Arbeitsstätte nicht gewährleistet ist.
• Fluchtwege, Notausgänge und Notausstiege müssen ständig freigehalten werden.
• Notausgänge und Notausstiege, die von außen verstellt werden können, sind von außen zu kennzeichnen und z. B. durch die Anbringung von Abstandsbügeln für Kraftfahrzeuge zu sichern.
• Notausgänge und Fluchttüren sind so eingerichtet, dass sie jederzeit von innen ohne fremde Hilfsmittel leicht geöffnet werden können. Dies gilt auch für verschließbare Türen (z.B. Panikschlösser).
• Fluchttüren sind so eingerichtet, dass sie in Fluchtrichtung aufschlagen.
• Das Erfordernis eines zweiten Fluchtweges ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung unter besonderer Berücksichtigung der bei dem jeweiligen Aufenthaltsort bzw. Arbeitsplatz vorliegenden spezifischen Verhältnisse, z. B. einer erhöhten Brandgefahr.
• Führen zweite Fluchtwege z.B. über Dachflächen, müssen diese auch den bauordnungsrechtlichen Anforderungen an Rettungswege entsprechen (z. B. hinsichtlich Tragfähigkeit, Feuerwiderstandsdauer und Absturzgefahr).
• Wendel- und Spindeltreppen sowie Steigleitern und Steigeisengänge sind im Verlauf eines ersten Fluchtweges nicht zulässig.
• Notausgänge und Fluchttüren sind keine Karussell- oder Schiebetüren, die ausschließlich manuell betätigt werden. Aufzüge sind als Teil des Fluchtweges unzulässig.
• Notausstiege weisen im Lichten mindestens 0,90 m in der Breite und mindestens 1,20 m in der Höhe auf.
• Notausstiegfenster haben Fensterbrüstungen und -bänke, die so stabil ausgebildet sind, dass sie von Menschen betreten werden können. Je nach Höhe der Brüstung sind fest eingebaute Steighilfen angebracht.
• Es ist ein Flucht- und Rettungsplan zu erstellt, wenn Lage, Ausdehnung und Art der Benutzung der Arbeitsstätte dies erfordern. Auf der Grundlage dieser Pläne sind Räumungsübungen durchzuführen.
Quelle: Berufsgenossenschaft Holz und Metall
Fluchtwege - Berufsgenossenschaft Holz und Metall
Rettungs- und Fluchtwege
Dipl.-Ing. (FH) Josef Mayr, RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Übersicht zu Flucht- und Rettungsplänen
Deutsche Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit
Spindeltreppen – Fluchttreppen
EUROSTAIR GmbH
Der Brandschutzbeauftragte ist für den betrieblichen Brandschutz zuständig und wird vom Arbeitgeber schriftlich beauftragt bzw. ernannt. Er ist nur dem Unternehmer gegenüber verantwortlich und ihm direkt unterstellt. Sein Aufgabenbereich liegt hauptsächlich im vorbeugenden Brandschutz.
Der Brandschutzbeauftragte muss kein Betriebsangehöriger sein.
Die Grundlagen eines Brandschutzbeauftragten sind in der Richtlinie der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V. (vfdb) 12-09/01 (Bestellung, Aufgaben, Qualifikation und Ausbildung von Brandschutzbeauftragten) festgelegt.
Der Brandschutzbeauftragte muss Gefahren frühzeitig erkennen, richtig beurteilen und evtl. Gegenmaßnahmen vorschlagen können. Er wird bei allen betrieblichen Entscheidungen, die den Brandschutz betreffen, hinzugezogen.
Die Hauptaufgaben im Unternehmen sind:
• Brandschutzordnung kennen
• Alarmpläne erstellen
• Feuerwehreinsatzpläne erarbeiten
• Räumungspläne und Katastrophenabwehrpläne erstellen
• Überwachung bei der Beseitigung brandschutztechnischer Mängel
• Organisation und Überwachung der innerbetrieblichen Brandschutzkontrollen
• Beratung in Fragen des Brandschutzes
• Brandschutzschulungen durchführen
• Brandschutzübungen veranlassen
• Betriebsbegehungen durchführen
Sicherheits- bzw. Präventionsportal - Brandursachen - Rainer Schwarz, KHK i. R., brand-feuer.de
Ein Brandschutzgutachter ist ein Sachverständiger für den baulichen, technischen und organisatorischen Brandschutz. Staatlich anerkannte Brandschutzsachverständige sind berechtigt, im Auftrag von Bauherren Prüfungen im Baugenehmigungsverfahren und die Bauüberwachung zu übernehmen
Da die Bezeichnungen " Gutachter“ und "Sachverständiger“ nicht gesetzlich geschützt sind, haben die Industrie- und Handelskammern (IHK) die staatliche Aufgabe übernommen, Sachverständige öffentlich zu bestellen und zu vereidigen. Die Zulassung als Sachverständiger setzt umfangreiche Kenntnisse voraus, ist mit Auflagen verbunden und dokumentiert eine besondere Sachkunde.
Die IHK’s veröffentlichen eine Liste aller öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen.
Die Aufgabengebiete bestehen in der Beratung von Bauherrn und Betreibern von Sonderbauten (z. B. gewerblichen Bauten, öffentlichen Gebäuden, Hochhäusern, Schulen, Krankenhäusern, Einkaufszentren) und in der Erstellung von Brandschutzkonzepten und -gutachten für diese Gebäude.
Jeder Betrieb muss auf Grundlage der DIN 14096 Teil 1 bis 3 (A bis C) in eigener Verantwortung eine Brandschutzordnung erstellen. Hierbei sind die örtlichen Gegebenheiten, betriebliche Abläufe und Strukturen zu berücksichtigen. Regelmäßige Schulungen und Übungen sollten die Regelungen festigen und überprüfen.
Teil A (Aushang) richtet sich an alle Personen (z.B. Beschäftigte, Mitarbeiter von Fremdfirmen oder Besucher), die sich in einem Betrieb bzw. Gebäude aufhalten.
Teil B (für Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben) richtet sich an die Personen (z.B. Beschäftigte, Bewohner), die sich nicht nur vorübergehend in einem Gebäude aufhalten.
Anforderungen für die einzelnen betrieblichen Gefahren:
• Brandverhütung
• Verhütung der Brand- und Rauchausbreitung
• Flucht- und Rettungswege
• Melde- und Löscheinrichtungen
• Verhalten im Brandfall
• Art der Brandmeldung
• Alarmsignale und Anweisungen
• In Sicherheit bringen
• Vorgehensweise bei der Brandbekämpfung
• Spezielle Gefahren und Verhaltensregeln
Teil C (für Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben) richtet sich an Personen (z.B. Brandschutz-beauftragte), denen besondere Aufgaben im Brandschutz übertragen wurden.
Folgende Punkte sollten vorhanden sein:
• Zur Brandverhütung
• Zur Alarmierung
• Zu Sicherheitsmaßnahmen für Personen, Tiere und Sachwerten
• Zu Löschmaßnahmen
• Zur Vorbereitung von Feuerwehreinsätzen
• Zur Nachsorge
In vielen gewerblichen Gebäuden (Lager, Werkstätten, Tiefgaragen, aber auch Büro- und Verkaufsräumen) sind Rauchmelder, Brandmelde-, Rauch- und Wärmeabzuganlagen nicht ausreichend. Hier wird eine aktive Brandlöschanlage vorgeschrieben. Am häufigsten werden Sprinkleranlagen mit den vorgenannten Anlagen kombiniert.
Neben Feuerlöschteichen werden Löschwasserbehälter (unterirdische, überdeckte Speicher) für die vom Trinkwassernetz unabhängige Versorgung mit einer oder mehreren Löschwasserentnahmestellen eingebaut.
>>>> hier ausführlicher <<<<
Brandschutzkonzepte und Brandschutznachweise -
Hinweise und Information zur Planung und Prüfung
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)
Brände, Verkehrsunfälle, Extremwetterschäden (umgestürzte Bäume, abgedeckte Dächer) oder die Katze in der Baumkrone. Jetzt ist die Feuerwehr gefragt. Was viele nicht wissen, rund 95 % aller Feuerwehrleute in Deutschland sind Ehrenamtliche. Hier wird erklärt, was die Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr so besonders macht, wie man sich selbst engagieren kannst und wie man sich im Brandfall richtig verhält.
>>>> hier ausführlicher <<<<
Brandschutz im Holzbau
Beim Thema Brandschutz bei mehrgeschossigem Bauen mit Holz macht jede Landesbauordnung eigene Vorschriften. Außerdem spricht die jeweils örtliche Feuerwehr beim Baugenehmigungsverfahren mit. So hat der Holzbau wegen falscher Vorbehalte bezüglich seiner Brandfestigkeit immer noch mit einer breiten Durchsetzung am Markt zu kämpfen.
Holz ist brennbar, das ist richtig. Aber diese Eigenschaft schließt nicht aus, dass mittlerweile selbst Hochhäuser in Holzbauweise erstellt werden dürfen, sofern entsprechende Ausgleichmaßnahmen ergriffen werden, denn Holz brennt kontrolliert. Während also eine ungeschützte Stahlstütze unter Umständen unvermittelt unter der großen Hitze eines Brandes wegknicken könnte, bildet sich auf der Oberfläche des Holzes eine Schutzschicht aus Holzkohle und sorgt für eine kalkulierbare Widerstandsdauer.
Im Einfamilienhausbau hat sich das Bauen mit Holz schon lange etabliert, wenngleich sich auch hier immer noch wieder Baufamilien auch aus Sorge vor einem Brand gegen einen Holzbau entscheiden. Dass dies jedoch keine berechtigte Angst ist, wird vielleicht deutlich, wenn man bedenkt, dass inzwischen sogar bis zu 14-geschossige Hochhäuser in Holzbauweise errichtet werden.
Der Trend zum nachhaltigen Bauen mit Holz wird besonders im mehrgeschossigen Bau mit Brettsperrholz* (BSP | CLT) immer beliebter. Dieser Werkstoff ist nicht nur tragfähig und vielseitig einsetzbar, sondern verbessert auch die Wohnqualität erheblich. Obwohl Holz als "normal entflammbar" klassifiziert ist, kann es je nach Konstruktion dennoch einen vergleichbaren Feuerwiderstand wie Beton oder Mauerwerk bieten.
* Brettsperrholz (CLT - Cross Laminated Timber) bzw. Brettsperrholzplatten (BSP) werden meist objektbezogen produziert und werden mehrheitlich aus Fichte hergestellt, doch auch Holzarten wie Kiefer, Lärche, Eiche und Weisstanne sind auf Anfrage erhältlich.
Ein wichtiger Aspekt beim Brandschutz im Holzbau ist daher vor allem der bauliche Brandschutz, insbesondere bei Elektro- und Rohrinstallationen, die raumabschließende Bauteile durchdringen. Dabei müssen Brandabschottungen die gleiche Feuerwiderstandsklasse wie die Holzbauteile erfüllen, damit die Schutzfunktion gewährleistet ist. Da sich Holz im Brandfall jedoch anders verhält als Massivbauteile, sind aus diesem Grund spezielle Prüfungen unbedingt erforderlich. Deshalb werden die Abschottungssysteme gezielt für den Einsatz in Holzwänden und -decken getestet.
Der gebäudetechnische Brandschutz im Holzbau, insbesondere in der Nähe von Rohrleitungen, ist besonders wichtig, um einerseits die Ausbreitung von Feuer zu verhindern und andererseits die Strukturintegrität des Gebäudes zuverlässig zu schützen.
Hier sind einige wichtige Aspekte:
• Brandabschottungen: An Stellen, an denen Rohrleitungen durch Holzbauteile mit Brandschutzanforderungen geführt werden, müssen geprüfte Abschottungen installiert werden, damit die Feuerwiderstandsfähigkeit nicht beeinträchtigt wird. Dabei bestehen diese Abschottungen häufig aus feuerfesten Materialien wie Brandschutzmörtel, Brandschutzplatten oder intumeszierenden (aufschäumenden) Materialien, die im Brandfall ihre Funktion zuverlässig erfüllen.
• Abstand halten: Zwischen Rohrleitungen und Holzbauteilen sollte ein angemessener Abstand eingehalten werden, um die Wärmeübertragung im Brandfall zu minimieren.
• Feuerbeständige Ummantelungen: Holzbauteile, die in der Nähe von Rohrleitungen liegen, können mit feuerbeständigen Ummantelungen versehen werden, um deren Feuerwiderstand zu erhöhen.
Brandschutz im Holzbau
Walraven GmbH
Baulicher Brandschutz, geprüft für den Holzbau
Rohr- & Kombiabschottungen im Holzbau
Walraven GmbH
Brandschutz im Holzbau – Entscheidend ist die richtige Planung
mb-netzwerk GmbH - Portal Ökologisch Bauen
Merkblatt Brandschutz
Kolektor Insulation GmbH
Eine Verbrennung (Feuer) ist eine sehr schnell ablaufende
Reaktion eines brennbaren Stoffes mit Sauerstoff (Oxidation) unter Flammenerscheinung. Bei dieser Art von Reaktion wird Wärme freigesetzt und an die
Umgebung abgegeben (exotherme Reaktion).
Man unterscheidet zwischen bestimmungsgemäß und nicht bestimmungsgemäß
brennenden Feuern. Während ein Kaminfeuer in der Regel kontrolliert werden kann, hat man Probleme, wenn das Feuer Gegenstände oder Räume betrifft, die nicht dafür vorgesehen sind.
Um ein Schadfeuer zu löschen, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und Hilfsmittel,
welche jedoch nicht immer geeignet sind oder sogar gefährlich für Feuerwehr werden können.
Um ein Schadenfeuer effektiv zu bekämpfen, muss ein Gruppenführer der Feuerwehr das richtige
Löschmittel zum Einsatz bringen. Hierzu müssen die
Vorrausetzungen und der Verlauf einer Verbrennung beurteilt werden, um die verschiedene
Löschmethoden und Löschmittel einzusetzen.
|
Ein Brand bzw. ein Feuer ist eine einfache chemische Reaktion. Diese kann nur stattfinden, wenn nachfolgend aufgeführten Faktoren zeitgleich und im richtigen Verhältnis zusammenfinden: • brennbares Material • Sauerstoff • Zündenergie |
>>>> hier ausführlicher <<<<
Brandschutzforschung der Bundesländer - Berichte in gedruckter Form
KIT – Die Universität in der Helmholtz-Gemeinschaft