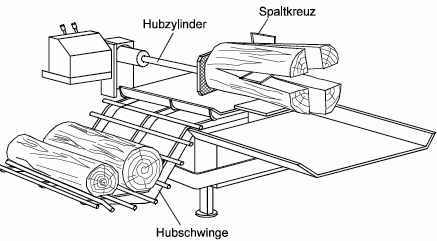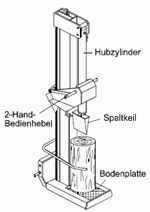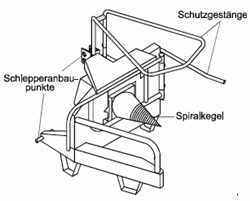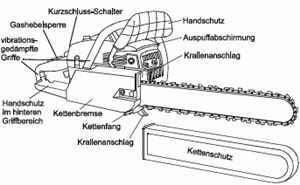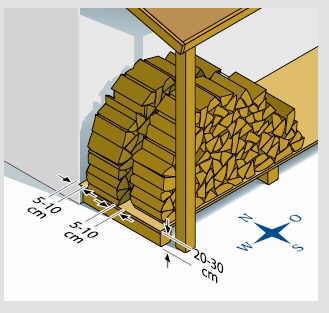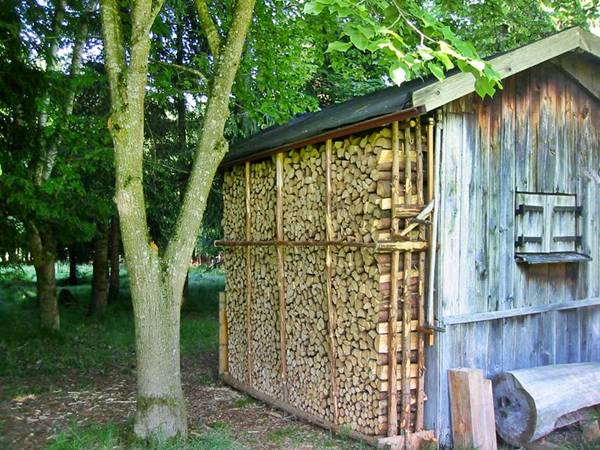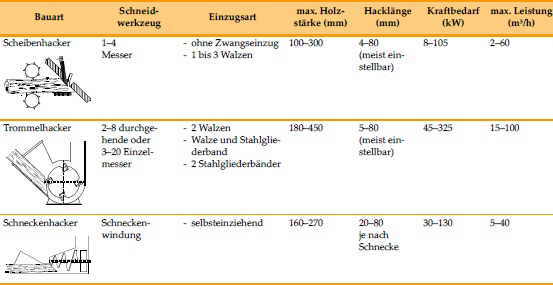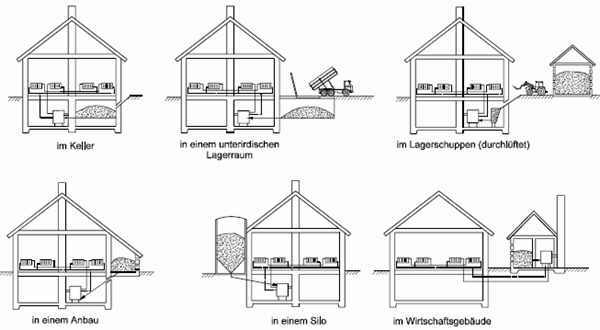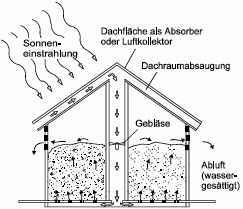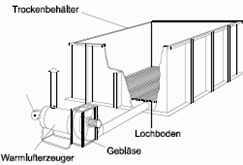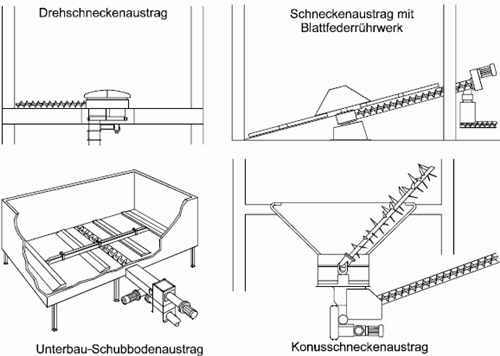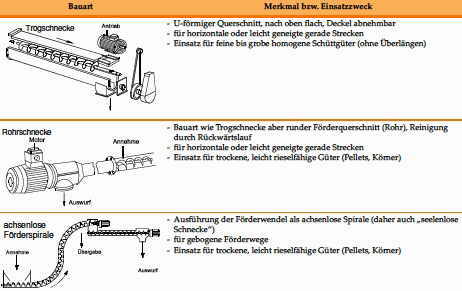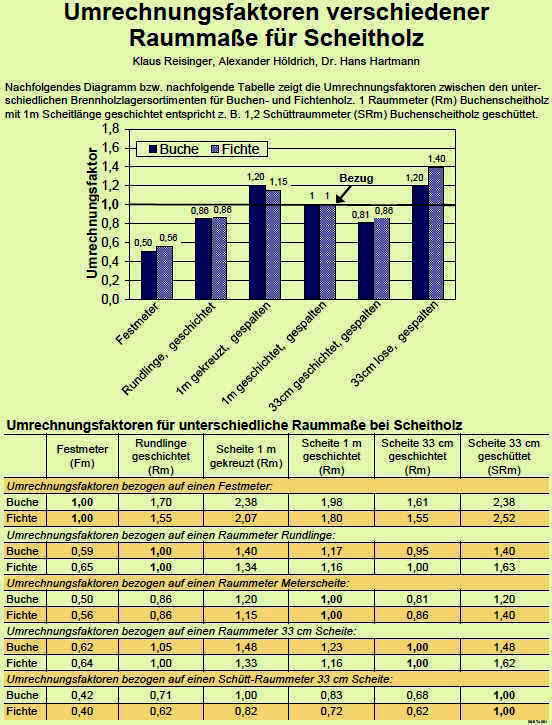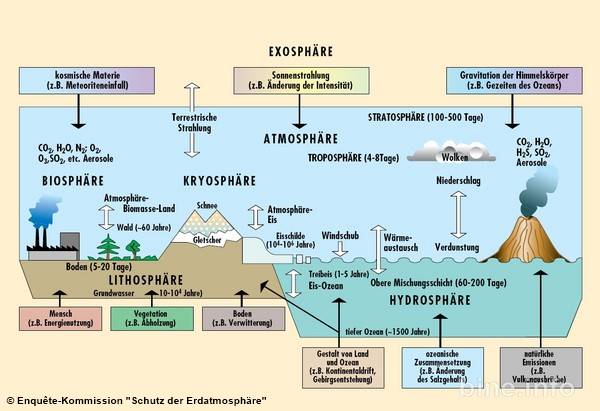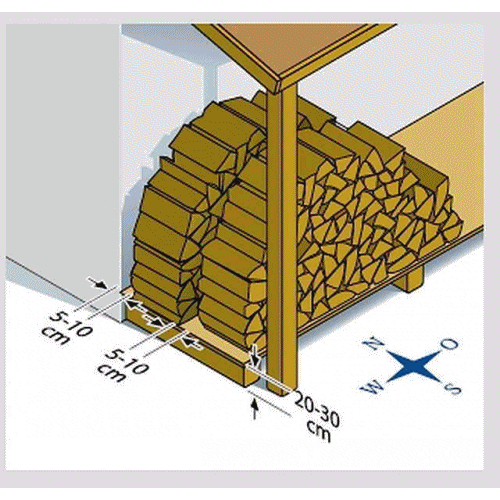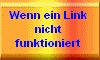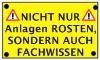| |
|
| |
|
|
Bevor man an die
richtige Holzlagerung denken kann, muss erst einmal
Holz geerntet und lagergerecht bearbeitet
werden. Das Holz kommt aus der Durchforstung und Ernte
von Waldholz. Auch stärkeres Holz aus der Landschaftspflege
wird als Brennholz (Scheitholz, Pellets, Brikett, Hackschnitzel)
angeboten. |
|
Waldholz |
|
Schlagabraum |
|
Kronenholz |
|
Das Brennholz
ist hauptsächlich Schwachholz und
Waldrestholz, das bei der Produktion von
möglichst hochwertigem Stammholz anfällt. Bei
diesem Schlagabraum handelt es sich minderwertige
Sortimente und Rückstände, die noch in Kronenderbholz,
Reisholz und Rinde unterteilt
werden. Aber auch nicht verwertbare Baumstämme
werden als Brennholz angeboten.
|
Bei Durchforstungsmaßnahmen,
die in Abständen von ca. 10 Jahren wiederkehrend durchgeführt
werden, fällt Schwachholz an. Es handelt
sich dabei um konkurrierende, kranke oder minderwertige
Bäume. Da es sich um Holz mit geringem Brusthöhendurchmesser
(BHD) zwischen ca. 7 und 20 cm handelt, ist es als Industrieholz
nicht zu gebrauchen. Es wird zu Hackschnitzel
(mit Feinästen, aber meist ohne Nadeln) oder zu stückigem
Brennholz (nach dem Entfernen des Reisholzes mit
weniger als ca. 7 cm Durchmesser) verarbeitet.
|
Das Waldrestholz
(Schlagabraum) das Holz, welches nach der
Holzernte übrig bleibt, weil es nicht industriell oder
anderweitig genutzt werden kann. Hier können das Kronenmaterial
oder die kurzen Stammabschnitte zu Hackschnitzeln
oder Scheitholz aufgearbeitet werden. Das Reisholz (inkl.
Nadeln) und auch ein Teil der anfallende Rinde (bei Waldentrindung)
verbleiben in vielen Fällen im Wald.
|
Die Aufarbeitung
des Schlagabraums zu stückigem Brennholz oder Hackschnitzeln
erfolgt durch den Forstbetrieb, einen Lohnunternehmer
oder private Nutzer (Selbstwerber).
Die Selbstwerber bekommen eine begrenzte Teilfläche
als "Flächenlos" zugewiesen
und führen die Aufarbeitung in Eigenregie durch. |
|
|
|
Bundesnaturschutzgesetz |
Das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz, BNatSchG) regelt, wann Sträucher oder Bäume geschnitten werden dürfen. Zusammengefasst ist es im Zeitraum vom 01.03. bis zum 30.09. verboten, Bäume zu schneiden und zu fällen. Die umfassenden Regelungen greifen auch dann, wenn auf privaten Grundstücken Sträucher oder Bäume geschnitten werden sollen.
Ein Verstoß entspricht einer Ordnungswidrigkeit, für die Geldstrafen verhängt werden. Dazu gelten jedoch Ausnahmen, Genehmigungspflichten sowie weitere Vorgaben der Bundesländer und Kommunen.
. |
|
|
|
Orkan "Christian
Hier stand einmal ein stattlicher Wald, der durch den Orkan "Christian" am 28. Oktober 2013 zerstört wurde. Der Orkan "Xaver" am 5. Dezember 2013 sorgte dann für den Rest. Die "Holzernte" im Katinger Watt konnte erst nach einem Jahr erfolgen, weil vorrangig die Schäden in den anderen Landesforsten Schleswig-Holsteins beseitigt werden mussten. Einige Wälder waren monatelang für die Besucher gesperrt.
Der Grund für diese totale Zerstörung war, dass viele Laubbäume wegen der milden Witterung noch Blätter trugen
und damit anfälliger gegen Starkwind waren.
Das Orkantief "Christian" (ca. 968 hPa) erreichte an der Westküste Schleswig-Holsteins die höchsten Windgeschwindigkeiten in der Zeit von 14 bis 15 Uhr (MEZ). An der Wetterstation Sankt Peter Ording des Deutschen Wetterdienstes wurden Böen von 172 km/h gemessen. An der dänischen Wetterstation Kegnaes Fyr, nahe der Schleswig-Holsteinischen Grenze, wurde eine Böe mit einer Geschwindigkeit von 193 km/h registriert.
Orkantief
CHRISTIAN – Der schwerste Sturm für den äußersten
Nordwesten und Norden Deutschlands seit mindestens 1999
|
|
| |
|
|
 Die "Ernte" eines kleinen Waldststückes im Katinger Watt ein Jahr nach dem Orkan "Christian"
Die "Ernte" eines kleinen Waldststückes im Katinger Watt ein Jahr nach dem Orkan "Christian"
|
|
|

Quelle: Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF)
|
Rettungspunkt
Die Grundlage für die Einführung von Rettungspunkten (sie werden auch Rettungstreffpunkt,
Notfall-Treffpunkt oder Anfahrtspunkt für Rettungsfahrzeuge genannt [Emergency access point]) war, in Notfällen die
Rettungsfahrzeuge (Rettungswagen, Polizei, Feuerwehr) schneller an den richtigen Ort zu leiten. Die Stellen sind mit Schildern
ausgestattet, auf denen die Euronotrufnummer 112 und ein Referenzcode angegeben sind.
Die Schilder sind nicht genormt und regional unterschiedlich beschriftet. In Deutschland wird ein weißes Kreuz
auf grünem oder rotem Hintergrund verwendet. Der Referenzcode kann ein Kfz-Kennzeichen oder eine
Kennnummer für den Landkreis mit einer fortlaufenden Rettungspunkt-Nummer nachgestellt sein. Diese Daten sind bei der
Rettungsleitstelle in entsprechenden Karten (z. B. forstliche Rettungspunkte) eingetragen.
Rettungspunkte-App "Hilfe im Wald"
> mehr |
|
|
|
Totholzhecke
Eine Totholzhecke (Reisighecke, Benjeshecke) ist eine sinnvolle und ökologische Alternative zur Verbrennung von Schnittholz. Die Totholzhecken besteht überwiegend aus dünnem Gehölzschnitt (Äste, Zweige), aber auch ein paar dickere Äste sollten eingelegt werden. Sie ersetzt in vielen Gegenden die in Schleswig-Holstein üblichen Knicks (Wallhecke). Sie ist ein geeigneter Lebens-, Brut- und Schutzraum für viele Tiere (Vögel, Nager, Igel, Insekten) und Pflanzen. Sie wird gerne als natürlicher Sichtschutz und ist außerdem ein hervorragender Windschutz eingesetzt.
Die Totholzhecke ist keine tote Hecke, wie es die Bezeichnung aussagt, sondern eine bereits seit alters her bekannte Weise, den Gehölzschnitt sinnvoll weiter zu verwenden. Hier wird das anfallende Geäst sauber zu einer ca 0,5 bis 1 Meter breiten und bis zu 1,5 bis 1,8 Meter hohen Wand in unbegrenzter Länge aufgeschichtet. Da das Holz in der Totholzhecke allmählich verrottet und in sich zusammensackt, kann immer wieder Schnittgut nachgefüllt werden. Sie wächst also jährlich mit.
Viel wichtiger ist aber der ökologische Wert. In vielen Wohnsiedlungen findet man oft nur noch sauber geputzte Gärten ohne Wildpflanzen (Unkraut) und viel Rasenflächen und abundzu ein paar Zierpflanzen, die angeblich "wenig" Arbeit machen. Pflanzenhecken werden durch Drahtgitter- und Flechtzäune ersetzt. Und dann wundert man sich, warum man so wenig Vögel (z. B. Amsel, Singdrossel, Blaumeise, Kohlmeise, Haussperling, Buchfink, Rotkehlchen) und Nutzinsekten (z. B. Pflanzenwespe, Taillenwespe, Schlupfwespe, Marienkäfer, Laufkäfer, Ohrwurm) sieht
Die Totholzhecke ist besonders der Lebensraum für Rotkehlchen und Zaunkönig, Insekten (Hummeln, Wildbienen, Käfer) und Kleinsäuger (Igel, Wiesel, Maus). Aber auch für andere Vogelarten ist die Hecke von Bedeutung, denn sie bieten nicht nur den flügge gewordenen Jungvögeln Verstecke vor Katzen und Beutegreifern, sondern bieten auch Nahrung in Form von Insekten. Auch Pflanzen können sich dort ansiedeln, die durch Samen, die Vögel eintragen, entstehen.div>
 Vor dem Anlegen einer Totholzhecke an oder in der Nähe der Grundstücksgrenze sollte man sich bei der Gemeinde über evtl. bestehende Vorschriften informieren. Auch ein Gespräch mit den Nachbarn ist zu empfehlen, um unnötigen Ärger zu vermeiden, denn eine derartige Hecke ist nicht nach jedem Geschmack. Vor dem Anlegen einer Totholzhecke an oder in der Nähe der Grundstücksgrenze sollte man sich bei der Gemeinde über evtl. bestehende Vorschriften informieren. Auch ein Gespräch mit den Nachbarn ist zu empfehlen, um unnötigen Ärger zu vermeiden, denn eine derartige Hecke ist nicht nach jedem Geschmack.
|
|
.
.
. |
|
________________________________________________________ |
|
Parkett
Bevor das geerntete Holz
zu Brennholz (Scheitholz, Pellets, Brikett, Hackschnitzel)
verarbeitet wird, sollte bedacht werden,
dass edlere Hölzer (z. B. Buche, Eiche, Ulme,
Ahorn, Nussbaum) eigentlich zu schade sind, um durch den Schornstein
entsorgt zu werden. Zur Verbrennung sollte erst einmal
das Waldrestholz (Schlagabraum [Schwachholz,
Waldrestholz, Kronenderbholz, Reisholz, Rinde]), welches nach der
Holzernte übrig bleibt, weil es nicht industriell
oder anderweitig genutzt werden kann, verwendet werden.
Holz sollte als Bauholz (Vollholz,
Brettschichtholz, Holzwerkstoff), zur Herstellung von Möbeln,
zur Verarbeitung als Funiere und
Parkett eingesetzt werden. Parkett
ist ein hochwertiger Fußbodenbelag, der aus
kleinteiligen Holzstücken einen tragfähigen Untergrund bildet,
keine Fugenbildung (sehr hygienisch) hat, hygroskopisch ist und raumklimaregulierend
wirkt. Bei der Auswahl des Herstellers sollte besonders auf Qualität
und Erfahrung geachtet werden. Der Hersteller sollte neben der vorgeschriebenen
Gewährleistung eine Garantie
von mindestens 20 Jahre geben. Eine Bezugsquelle für Holzböden
ist z. B. die Holzmarke
Hori.
Parkett
und Fußbodenheizung
Im Gegensatz zur allgemein verbreiteten
Meinung spricht nichts gegen Parkett auf Fußbodenheizungen
oder -temperierungen. Außerdem ist der Parkettboden
im Gegensatz zum Fliesenboden fusswarm, was besonders
dann vorteilhaft ist, wenn die Heizung nicht in Betrieb ist.
Auf der Fussbodenheizung sind aber nicht alle
Holz- und Parkettarten (z. B. Mehrschichtparkett) geeignet.
Man sollte sich immer durch den Hersteller bestätigen
lassen, das der angedachte Parkettboden geeiget ist
und wie es mit der Garantiezeit aussieht.
Geeignet ist ein Massivparkett
mit Nut und Feder oder Mehrschicht-Einzelstab-Parkett
(10 bis 14 mm) mit den entsprechenden Freigaben der Hersteller, Mosaikparkett
(8 mm), Stabparkett (bis max. 19 mm), Fertigparkett
(3-schichtig) je nach Wärmedurchlaßwiderstand
schubfest verklebt aus geeigneten Hölzern. Der
Holzfußboden sollte eine Dicke von maximal 22 mm nicht übersteigen.
Die Wärmeabgabe eines Holzfußbodens
wird durch den Wärmedurchlasswiderstand
des Holzes definiert. Bei der Wärmeleitfähigkeit
spielt die Dichte des Holzes eine
große Rolle. Hartholz leitet um ein Drittel
besser als Weichholz.
Um eine ausreichende Wärmeabgabe an den zu
beheizenden Raum zu erreichen, soll der Wärmeleitwiderstand des
Bodenbelages möglichst nicht größer als R = 0,15 (m2
K) / W sein.
Die Wärmeleitwiderstände der einzelnen
Parkettarten betragen wie folgt:
Mosaikparkett (Eiche, 8 mm dick) R = 0,038 (m2K)/W
Stabparkett (Eiche, 22 mm dick) R = 0,105 (m2K)/W
Fertigparkett (10 bis 15 mm dick) R = 0,08 bis 0,11 (m2K)/W
Sie liegen also insgesamt im günstigen Bereich < 0,15 (m2K)/W.
Soweit bei der schwimmenden Verlegung von Fertigparkettelementen eine
Rippenpappe von ca. 2,5 mm Dicke zu berücksichtigen ist, sind
weitere 0,05 (m2K)/W hinzuzurechnen.
Auf Parkettfußböden mit Fußbodenheizung
sollten möglichst keine dicken Teppiche gelegt
werden. Eine Verlegung auf einer Elektro-Fußbodenheizung
muss immer durch den Hersteller der Elektro-Fußbodenheizung
freigegeben werden.
Das Verkleben des Parketts (auch beim
Mehrschicht-Parkett) ist immer der schwimmenden Verlegung
vorzuziehen, da Luftpolster die Heizleistung erheblich
minimiert. Ungeeignet ist Hirnholzparkett
oder große Einzelelemente (Massivdielen), da
hier Spannungsschäden auftreten oder eine verstärkte
Fugenbildung entstehen können. Holzarten
mit kurzen Feuchtewechselzeiten wie z. B. Buche und
Ahorn neigen stärker zu ausgeprägten Fugen
als z. B. Eiche.
Vor dem Verkleben
des Parketts muss der Untergrund richtig vorbereitet
werden. Ein frischer Zementestrich ist, je nach Estrichdicke
und -art, frühestens nach 21 Tagen, Anhydritestriche
frühestens nach 7 Tagen aufzuheizen. Nach
dem Erreichen der Endfestigkeit,
ist die Heizung mindestens 14 Tagen in Betrieb zu
nehmen. Dabei wird mit ca. 2/3 der ausgelegten maximalen
Vorlauftemperatur gefahren und nur kurz
die Maximaltemperatur der Fussbodenheizung
betrieben. Hierüber muss ein Aufheiz- und Prüfprotokoll
erstellt werden. Ein bis zwei Tage
vor der Verlegung ist die Heizung abzuschalten.
Je nach der Außentemperatur sollte die Oberflächentemperatur
des Unterbodens ca. 18 °C nicht
übersteigen.
Während der Verlegung
sollte die Raumtemperatur 18 - 20 °C betragen
(DIN 18356, DIN 18365, DIN 18367) und die Fußbodenheizung
abgeschaltet sein. Außerdem muss die Normfeuchte
der jeweiligen Parkettarten (z. B bei Stab- und Mosaikparkett
9 - 11 % und für Fertigparkett 8 - 10 %) eingehalten werden.
Auf Estrichen sind schubfeste, weitgehend temperaturstabile
und qualitativ gute Parkettklebstoffe zu verwenden.
Schubfest verklebtes Parkett arbeitet weniger und die Wärmeübertragung
ist deutlich höher als bei schwimmend verlegten Fertigparkettsorten.
Bis zum vollständigen Abbinden des Klebers
(ca. 2 - 10 Tage je nach Klebstofftyp und Verlegebedingungen) sollte
die Oberflächentemperatur des Estrichs ca. 15 bis 18 °C betragen.
Besonders wichtig ist die richtige Oberflächenbehandlung
des verklebten Parketts. Bei wasserbasierenden und lösemittelhaltigen
2-Komponenten und sehr spröden Lacken kann es zur Seitenverleimung
der Einzelelemente kommen, was zu unerwünschten Block-
und Fugenbildungen führt. Um dieses zu vermeiden,
sollten geeignete Grundierungen oder Lacke mit hoher Elastizität
verwendet werden. Auf Fußbodenheizungen sollen ausschließlich
aushärtende Öle eingesetzt werden. Hartwachsöle sind
ungeeignet. Geölte Böden sollten mit einer geegneten
Holzbodenseife gepflegt werden. Wachshaltige Pflegemittel sind ungeeignet.
Ca. 1 - 2 Tage nach der Endbehandlung
und zu Beginn der Heizperiode darf
die Heizung nur stufenweise (ca. 5 °C/Tag) in
Betrieb genommen werden. |
|
|
Zum Fällen der Bäume
wird eine Motorsäge und selten eine Axt
verwendet. Zur Weiterverarbeitung werden verschiedene Äxte benötigt.
|
Für die verschiedenen Einsatzzwecke
werden unterschiedliche Äxte angeboten. Bei der Arbeit im Forst
kommen vor allem die Universal-Forstaxt, die Iltisaxt
und die Sappiaxt in Frage, da diese Äxte leicht
sind und für das Entasten verwendet werden können. Die Sappiaxt
besitzt einen Sappihaken, um schwächeres Holz
zu wenden oder vorzuliefern. Die Holzfälleraxt
wird dagegen heute außer bei Holzfällermeisterschaften kaum
noch benützt. Bei häufigen Keilarbeiten oder
wenn das Holzspalten bereits im Wald manuell erfolgen
soll sind andere, schwerere Axttypen vorteilhafter, während eine
normale Spaltaxt oder eine Iltisaxt hierbei leicht
beschädigt und unbrauchbar werden kann. |
Bei der Wahl der Axt ist auch
auf den richtigen Stiel zu achten. Er ist aus Eschen-
oder Hickoryholz, bei Spezialäxten auch aus Vinyl.
Die Stiellänge wird individuell abgestimmt, sie sollte ungefähr
gleich der Armlänge sein. Je größer die Kraftausübung
sein soll, desto länger ist der Stiel. |
|
Quelle:
TFZ - Technologie- und Förderzentrum Bayern |
|
Für das Spalten
von Hand werden Spaltäxte und Spalthammer
mit dazugehörigen Keilen verwendet. Bei großen
Klötzen aus Weich- und Hartholz wird ein Spalthammer mit seinem
großen Gewicht verwendet. Bei kleineren Klötzen, die man
mit einem Schlag spalten kann, wird die leichtere Spaltaxt verwendet.
Für Hartholz wird eine etwas dickere Klinge als für Weichholz
gewählt. Es gibt auch Spaltäxte, die für beide Holzarten
geeignet sind. Die Spaltäxte müssen für den Zweck geeignet
sein, damit sie beim Treiben von Keilen nicht beschädigt
und unbrauchbar werden. |
|
|
Das Holz wird immer noch zu
einem großen Teil in Handarbeit mit der Axt
gespalten. Bei größeren Holzmengen werden zunehmend mechanische
Holzspalter angewendet. |
Für die gewerbliche
Zerkleinerung bzw. Spaltung von gerücktem
Holz zu ofengängigen Holzstücken werden hauptsächlich
Keilspalter eingesetzt. Diese können als Schlepperanbaugeräte
mit Zapfwellenantrieb ausgeführt sein. Bei dem Keilspalter wird
ein Spaltkeil hydraulisch über einen Hubkolben in das eingeklemmte
Holz getrieben. Das Holzstück kann auch gegen einen fest stehenden
Keil oder eine Klinge gedrückt werden. Diese Geräte gibt es
in vertikaler und horizontaler Ausführung.
|
Bei dem Spiralkegelspalter
wird das Holz an einen rotierenden Spiralkegel gedrückt, der direkt
von einer Schlepperzapfwelle oder einem Elektromotor angetrieben wird.
Der Kegel besteht aus spiralförmigen Windungen, die sich selbsttätig
in das arretierte Holzstück hineinbohren und dieses in Faserlängsrichtung
aufspalten. Wegen der hohen Unfallgefahr dürfen
diese Geräte in Deutschland inzwischen nicht mehr vertrieben werden. |
| |
|
|
horizontaler
Keilspalter |
vertikaler
Keilspalter |
Spiralkegelspalter |
| Quelle:
TFZ - Technologie- und Förderzentrum Bayern |
|
|
|
|
Die Motorsäge
(Kettensäge) ist das wichtigste
Gerät zum Fällen von Bäumen
und dem Zuschneiden der Holzscheitlängen.
Auf Grund des hohen Unfallrisikos, ist
es für Selbstwerber in den meisten
Bundesländern vorgeschrieben, einen "Motorsägenschein"
vorzulegen, bevor man von der Forstverwaltung Holz zugewiesen
bekommt. |
In einem Lehrgang
zum Motorsägenschein (Kettensägeschein) bei
dem Forstamt oder der Landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft wird der richtige Umgang
mit der Motorsäge und die dazugehörenden Unfallverhütungsvorschriften
vermittelt. |
| . |
|
|
|
Motorsäge
- Kettensäge |
Quelle:
TFZ - Technologie- und Förderzentrum Bayern |
| . |
|
Motorsäge |
|
|
Motorsägen
für die Selbstwerbung haben eine Leistung von 1,5
bis 3 kW in Frage. Diese Sägen sind mit einer
elektronischen Zündanlage, Kettenbremse
und automatischen Kettenschmierung ausgestattet.
Es sollte immer eine Sicherheitskette, die die Rückschlaggefahr
der Motorsäge vermindert, verwendet werden, .Die empfohlene
Schwertlänge liegt bei 30 bis 40 cm
(Profisägen bis 120 cm). |
| Die Säge sollte folgende Sicherheitsmerkmale
erfüllen: |
- Antivibrationsgriffe
- Sicherheitskette (reduzierte
Rückschlaggefahr)
- Schutzköcher (verhindert
Verletzungen an der scharfkantigen Kette beim Transport)
- Gashebelsperre (verhindert
eine Gefährdung durch ungewolltes Gasgeben)
- Kettenfangbolzen (ist am Ketteneinlauf
montiert und fängt eine gerissene Kette auf)
- Kettenbremse (bietet Schutz,
falls die Säge unerwartet nach oben ausschlägt.
Diese Gefahr besteht vor allem, wenn versucht wird, mit
der Schienenspitze zu sägen)
|
| Weitere Ausstattung |
- ein Kombinationsschlüssel
zum Wechseln der Zündkerze und zum Kettenspannen
- eine Feile zum Nachschärfen
der Kette (mit Feilhilfe)
- ein Doppelkanister für
Kraftstoff und Kettenschmieröl
|
|
|
Für den gelegentlichen
Gebrauch bei wenig Holzarbeiten werden auch Elektro-Kettensägen
und Akku-Kettensägen angeboten. Hier gelten die
gleichen Regen wie sie bei Motorsägen vorgeschrieben sind. |


Schadholz
|
|
Durch die Orkane
"Christian" (bis 191 km/h) und
"Xaver" (bis 150 km/h) in Norddeutschland
liegen z. B. in Schleswig-Holstein zwischen
480 000 und 600 000 Festmeter
(Fm) Schadholz in den Wäldern.
Nachdem die Straßen und Wege geräumt und Gefahrbäume
entfernt wurden, liegen ein großer Teil dieser Hölzer
zur Verarbeitung als Scheitholz und Hackschnitzel
und zum Abtransport bereit.
Um diese Holzmengen zu verarbeiten und abzutransportieren,
haben sich "Holzheizer" (private
Nutzer [Selbstwerber]) zu Arbeitsgemeinschaften
zusammengeschlossen. Dadurch ist ein effektiver Werkzeugeinsatz
und der Abtransport durch die stark aufgeweichten Wege kostengünstig
zu gestalten.
Kettensägen, Spaltäxte
und Spalthammer mit den dazugehörigen
Keilen haben alle Holzheizer. Aber die großen
Holz- und Kronenholzmengen
und die schlechte Zugänglichkeit zu den Arbeitsstellen
im Wald machen die Anschaffung der notwendigen Maschinen
und Werkzeuge nur in solchen Arbeitsgemeinschaften
sinnvoll.
|
|
|
| |
| Eine
fachgerechte Lagerung über zwei bis drei Jahre
ist entscheidend für einen guten Wirkungsgrad bei der Verbrennung.
Um ein Wassergehalt von unter 20 % zu erreichen, sollten die Holzscheite
nicht zu groß sein. Eine Dicke von 7 bis 10 cm und eine Länge
von 33 bis 50 cm ist je nach der Art des Ofens bzw. Kessels zu empfehlen.
Der Heizwert von Scheitholz (ca. 4,0 und 4,5 KWh/Kg)
ist abhängig von der Holzsorte bzw. Holzart. |
|
Beispiel
- Holzlagerung |
Quelle:
Unopor |
|
Ratschläge
zur Holzlagerung |
• Das Holz sollte
nach dem Schlagen auf gebrauchsfertige Stücke gesägt
und keilförmig gespaltet werden
• Kleinere Holzscheite trocknen schneller aus
• Damit das Holz nicht vermodert, sollte nicht
direkt auf dem Boden gelagert
• Für die richtige Belüftung von unten
eignen sich hervorragend Als Unterlage eignen sich Paletten
oder Vierkanthölzer
• Das Holz muss genügend Luft zum Trocknen
bekommen und nicht dem Regen oder Schnee ausgesetzt
werden
• Bei der Abdeckung mit Planen als Holzmieten
sollte zwischen dem lagernden Holz und der Plane eine
kleine Luftschicht bestehen
• Das Lagern unter Vordächern oder Holzlagerhütten
ist eine Alternative
|
Die Mindestlagerungsdauer
vor dem Verbrennen beträgt |
• bei Fichte
> 1 Jahr
• bei Birke,
Linde und Erle > 1 1/2 Jahre
• bei Eiche,
Buche und Obstbäume > 2 Jahre
|
Auf Grund der
langen Trocknungszeit ist ein Holzvorrat vorausplanend
und kontinuierlich anzulegen. |
|
|
Über die sinnvolle Lagerdauer von Scheitholz gibt es verschiedene Meinungen. Experten gehen von einer maximalen Lagerzeit von 5 Jahren aus und dass zu lang gelagertes Holz 3 % pro Jahr an Brennenergie verliert. Die durch Trocknung verloren gegangenen flüchtigen Inhaltsstoffe sind gering und nicht vermeidbar. Die natürlichen Abbauprozesse verringern aber den Heizwert des Holzes. Das gilt auch für den Verlust durch Trockenholzinsekten. Andere Experten vertreten die Meinung, dass lufttrockenes Scheitholz in der Regel bei trockener Lagerung nicht an Heizwert verliert.
Ein Heizwertverlust entsteht durch Insekten- und Pilzbefall infolge falscher Lagerung und wiederholter Befeuchtung. Lufttrockenes Scheitholz sollte im Sommer nicht in einem kühlen Keller eingelagert werden, denn die feuchtwarme Außenluft kondensiert am Scheitholz und fördert den Schimmelbefall.
|
Beispiele verschiedener
Lagerarten |
| |
|
|
| Quelle:
DUD_ |
Quelle:
der wahre Madmax |
Quelle:
Schwani |
| |
|
|
| Quelle:
Gerolf Lange |
Quelle:
Harry Crumb |
Quelle:
Seidlbaschtl |
|
| |
Scheitholz
Scheitholz wird aus stärker
dimensionierten Ast- und Stammstücken
hergestellt. Das Brennholz*
besteht aus den unterschiedlichsten Baumarten und hat je nach
Holzart verschiedene Brennweisen
und Heizwerte.
Ein echter Holzheizer
macht sein Holz selber.
Da das "Holzmachen"
zeitaufwendig und mühsam ist, bietet der Handel
Holzscheite in den Längen
von 1 m, 33 cm und 25 cm und einer Dicke
von 7 bis 10 cm an. Die Holzscheite
sollten immer keilförmig hergestellt werden.
Die Einmeterscheite sind nur für Holzvergaserkessel
geeignet und müssen für den Gebrauch in Kaminöfen
auf die passende Länge zugeschnitten werden.
Technisch getrocknetes
Holz (oft im Internet angeboten) kann auch übertrocknet
sein. Es sollte noch einige Zeit abgedeckt
im Freien gelagert werden.
Auch bei richtig gelagertem Holz
kann es bei einem ungünstigem Witterungsverlauf
zu einer wiederholten Aufnahme von Wasser
aus der Luft kommen. Deswegen ist es sinnvoll,
einen 2-Tagesvorrat zur "Nachtrocknung"
neben dem Ofen zu lagern.
Wichtig
ist außerdem, das die Scheite die richtige Restfeuchte
(10 bis 20 %, Ideal 15 - 17 %) aufweisen. Die Feuchte
der Holzscheite kann mit einem simplen
Trick festgestellt werden. Dabei wird ein Stück
Holz senkrecht gehalten und ein wenig Spülmittel
auf das obere Ende bzw. Fläche
gegeben. Danach pustet man durch das untere
Ende durch das Holz. Wenn das Spülmittel Blasen
wirft, dann ist das Holz trocken. Natürlich kann
die Restfeuchte auch mit einem Messgerät
geprüft werden. Dazu
sollte man es aber noch einmal spalten.
Nach
dem vollständigem Abbrand sollten nur
einzelne wenige Scheite (1 Lage), aber möglichst
nicht nur Scheit, auf das Glutbett
gelegt werden. |
|
*
Brennhölzer
Buchen sind die am häufigsten
eingesetzte Brennholz. Sie haben ein besonders schönes Flammenbild,
fast keinen Funkenflug und eine gute Glutentwicklung. Außerdem
ist der Heizwert sehr hoch und ist deswegen das ideale Holz für
den Kaminofen. Es ist sehr gut für
alle Kaminöfen mit Sichtfenster geeignet.
Eichen haben eine lange Brenndauer
und eignen sich daher besonders gut zur Wärmegewinnung bei Speicheröfen
(z. B. Grundofen)
oder Kachelöfen. In Kaminöfen sollten die Eiche nur verwendet
werden, wenn kein großer Wert auf ein schönes Flammenbild
gelegt wird.
Hainbuchen bzw. Weißbuchen
sind eine eigene Holzsorte, die auch im getrockneten Zustand ein sehr
hohes Gewicht aufweist und dadurch einen außerordentlich hohen
Heizwert hat.
Eschen haben das schönste Flammenspiel
aller Brennholzarten. Es ist wie die Hainbuche sehr hart.
Birken eignen sich besonders gut für
offene Kamine und Kaminofen mit Sichtfenster, da sie einen geringen
Funkenflug haben und wegen ihrer ätherischen Öle bläulich
schimmernd verbrennt und einen angenehmen Geruch haben.
Kiefern und
Fichten brennen gut an und eignen sich am besten
als Anzündholz (Anmachholz). Die harzreichen Hölzer neigen
zum " Spritzen". Dabei verstopfen schmelzende Harze die
Wasserleitungsbahnen im Scheitholz und das verdampfende Wasser kann
nicht mehr entweichen und sprengt das Holz.
Pappeln und Weiden
brennen schnell ab und eignen sich deswegen als s. g. "Sommerholz",
also wird dann eingesetzt, wenn weniger Heizleistung gebraucht wird.
|
Bei der Verbrennung von nassem
Holz entstehen schädliche und geruchsintensive Emissionen.
Auch der Heizwert sinkt und die Feuerungsanlage inklusive Schornstein
kann verteeren. Es besteht Glanzruß
und die Gefahr eines Rußbrandes
steigt extrem. |
Der
durchschnittliche Heizwert von lufttrockenen Holzarten
(ca. 15%) |
| Holzsorte |
kWh/Raummeter |
kWh/Festmeter |
kWh/kg |
| Robinie |
2100 |
3000 |
4,10 |
| Eiche |
2100 |
2900 |
4,20 |
| Buche |
2100 |
2800 |
4,00 |
| Hainbuche |
2200 |
2900 |
4,20 |
| Ulme |
1900 |
2800 |
4,10 |
| Birke |
1900 |
2700 |
4,30 |
| Ahorn |
1900 |
2600 |
4,10 |
| Kiefer |
1700 |
2300 |
4,40 |
| Lärche |
1700 |
2300 |
4,40 |
| Douglasie |
1700 |
2200 |
4,40 |
| Esche |
1900 |
2900 |
4,10 |
| Fichte |
1500 |
2100 |
4,50 |
| Erle |
1500 |
2100 |
4,10 |
| Tanne |
1400 |
2000 |
4,50 |
| Weide |
1400 |
2000 |
4,10 |
| Pappel |
1200 |
1700 |
4,10 |
|
|
Herstellung
und Lagerung - Hackschnitzel |
Bevor die Hackschnitzel
gelagert werden können, müssen sie erst einmal mit
Hilfe eines Hackers aus Rest- und
Schwachholz (mit Feinästen, aber meist ohne Nadeln)
hergestellt werden. |
|
Güte
der Hackschnitzel |
Quelle:
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft |
|
Dieses Rest-
und Schwachholz eignet sich in vielen
Fällen nicht für die Nutzholzproduktion und
auch nicht für Brennholz in Kaminöfen
oder Grundöfen.
Eine möglichst gleichmäßige Größe
der Hackschnitzel und ein geringer Wassergehalt
sind Voraussetzungen für den Einsatz in den Heizanlagen.
Der verwendete Heizkessel sollte der Größe,
Wassergehalt und Feinanteil der Hackschnitzel angepasst
werden können. Für eine emissionsarme
Verbrennung ist es wichtig, nur "gutes"
Holz, so z. B. kein Abraumholz oder verschmutztes
und morsches bzw. faules oder sehr nasses Holz zu verwenden.
Auch der Rindenanteil sollte nicht zu
hoch sein, da sich durch Rinde der Ascheanfall
erhöht. Naturbelassenes Holz ohne Rinde weist in
der Regel nur einen geringen Aschegehalt
von etwa 0,5 bis 1 % auf. |
| |
|
|
| Trocknung von Hackholz |
- Grundsätzlich nur trockenes, lagerfähiges
Hackgut (< 30 %) verwenden
- Hackholz nach dem Schlagen mindestens einen
Sommer lang an einem luftigen, sonnigen Platz lagern
- In sonnigen Lagen kann das Material mit
den Nadeln liegen bleiben
- In niederschlagsreichen Sommermonaten empfiehlt
sich eine Abdeckung des Hackholzes
|
Hackholz,
das über einen Sommer zwischengelagert wird, hat
zum Zeitpunkt des Hackens im Spätsommer einen Wassergehalt von
25 bis 30 %. |
|
Herstellung
von Hackschnitzel |
|
mobile
Hacker |
Quelle:
TFZ - Technologie- und Förderzentrum Bayern |
|
Die Herstellung
von Hackschnitzel (grobes oder feines Schüttgut)
kann durch schnelllaufende Hacker und Schredder
(Häcksler) oder langsamlaufende Zerspaner (Trommelreißer)
erfolgen. Bei den Hackern (Scheiben-, Trommel-
oder Schneckenhacker) werden die Baum- oder Astteile
parallel zum Schneidaggregat zugeführt. |
|
Häcksler/Schredder |
Quelle:
Posch GmbH |
|
Bei einem Schredder
(Häcksler) und Zerspaner können
die Holzreste in Wirrlage zugeführt werden. Bei
dem Zerkleinern des Hackholzes wird
es stark zersplittert und bekommt eine
raue Oberfläche, dadurch wird
es im Frischzustand biologisch schnell abgebaut
und wird deswegen für die Brennholzbereitung nicht
eingesetzt. Sie werden bevorzugt zur Aufbereitung
von Mulchmaterial oder Kompostsubstraten
verwendet. |
| . |
|
|
|
Die Hackertechnik
beeinflusst die Hackschnitzelgröße und -form,
die für die Verwertungs, Transport- und Lagereigenschaften wichtig
sind. Deswegen werden folgende Eigenschaften gefordert: |
- Gleichmäßige Kantenlängen
zur Verbesserung der Fließ- und Fördereigenschaften
- Vermeidung von Überlängen durch
vollständige Erfassung auch der feinen Zweige und Stiele (zur
Vermeidung von Brückenbildung im Lager)
- Saubere Schnittstellen und geringe Faser-
oder Rindenbeschädigung zur Verringerung der spezifischen Oberfläche
des Hackguts (bessere Lagerfähigkeit)
- Vermeidung von Fremdstoffaufnahme
|
|
Scheibenhacker |
Quelle:
Althaus AG Ersigen |
|
Der Scheibenhacker
zerkleinert das Holz mit mehreren Messern,
die radial auf einer Schwungscheibe angeordnet
sind. Mobile haben zwischen zwei und vier Messer. Das Holz
wird über eine oder mehrere gegensinnig rotierende,
profilierte Einzugswalzen auf diese Scheibe zugeführt,
dabei ist die Zuführrichtung in einem Winkel von ca.
45° zur Scheibenebene, um den Kraftaufwand beim Schnitt
zu senken. Durch Messerschlitze in der Schwungscheibe gelangen
die abgetrennten Schnitzel auf die Rückseite der Scheibe
und werden dort über Wurfschaufeln (Windflügel)
in den Auswurfkanal geschleudert. |
Die Schnittlänge
der Schnitzel wird hauptsächlich durch die Höhe
des Überstandes der Messerklingen über dem Scheibenrad
bestimmt. Zur Erhöhung der Schnittlänge und zur
Anpassung an eine begrenzte Antriebsleistung können
einzelne Messer vollständig zurückgesetzt
werden. |
Bei der Herstellung
von Grobhackgut bis 150 mm Schnittlänge
wird eine Distanzplatte zwischen Scheibe und Messerhalterung
angebracht. Durch Variation der Einzugsgeschwindigkeit lässt
sich hierbei die tatsächliche Schnittlänge einstellen.
Quelle: TFZ - Technologie- und Förderzentrum
Bayern
|
|
|
Bei einem Trommelhacker
sind 2 bis 8 durchgehende oder 3 bis 20 versetzt angeordnete
Einzelmesser auf einer rotierenden, geschlossenen
oder innen hohlen Trommel befestigt. Die
Holzzufuhr erfolgt rechtwinklig zur Trommelachse,
wobei der Schnitt in einer Position stattfindet, in der
ein Winkel von ca. 25 bis 35° zum Gegenmesser vorliegt. |
Wie bei den Scheibenhackern
kann die Hackgutlänge durch Vor- oder
Zurücksetzen der Messer verändert werden. Meistens
werden Trommelhacker jedoch mit einer Nachzerkleinerungseinrichtung
in Form eines auswechselbaren Prallsiebes sowie einer zusätzlichen
Gegenschneide ausgerüstet. Bei solchen Bauformen wird
der Hackgutaustrag durch ein Gebläse unterstützt. |
Die Trommelhacker
werden in den höchsten Leistungsklassen angeboten;
dies betrifft sowohl den maximalen Holzdurchmesser, der
bei mobilen Geräten bis zu 450 mm betragen kann, als
auch die technische Durchsatzleistung, die bei maximal 100
m3/h liegen kann. Quelle:
TFZ - Technologie- und Förderzentrum Bayern |
|
|
Trommelhacker |
Quelle:
Althaus AG Ersigen |
|
|
ich suche
ein Bild |
Schneckenhacker |
Quelle:
|
|
Bei Schneckenhacker
rotiert eine konisch verlaufende, meistens waagrecht liegende
Schnecke in einem langgestreckten, ebenfalls
konisch verlaufenden Trichter. Der Grat
der Schneckenwindungen besteht aus einer aufgeschweißten
Hartmetallkante, die zu einem glatten Messer angeschliffen
wurde. Durch Rotation wird das Holz vom spitzen Ende des
Schneckenkegels erfasst und eingezogen,
wobei es unter ständigem Kraftschluss geschnitten wird.
Der Austrag erfolgt wie bei den Scheibenhackern über
Wurfschaufeln, die am hinteren Ende an der Schneckenwelle
aufgeschweißt sind. Die Hackgutlänge
lässt sich beim Schneckenhacker kaum beeinflussen,
sondern entspricht der Steigung der Schneckenwindungen. |
Auch ist die Beschickung
auf Grund des relativ engen Einzugstrichters bei sperrigem
Material schwieriger als bei den anderen Hackertypen. |
Quelle:
TFZ - Technologie- und Förderzentrum Bayern
|
|
|
Alle
drei Verfahren werden in stationärer,
aber auch in mobiler (versetzbarer) Ausführung
für die Erzeugung von Waldhackschnitzeln angeboten.
Bei der Einsatzplanung ist ein bestimmter Mindestplatzbedarf
für das Arbeiten im Wald oder am Betriebshof zu berücksichtigen,
die in den technischen Unterlagen der Hersteller angegeben sind. |
|
Lagerung
von Hackschnitzel |
|
Quelle:
TFZ - Technologie- und Förderzentrum Bayern |
|
| Bei der Lagerung des
Schüttgutbrennstoffes "Hackschnitzel"
(biogenes Material) gibt es einige Risiken. |
- Verlustrisiko > Substanzverlust durch
biologische Prozesse
- Brandrisiko > Selbstentzündung
- Gesundheitsrisiko > Pilzwachstum und
Pilzsporenbildung
- Umweltrisiko > Geruchsbelästigung
- Qualitätsrisiko > Wiederbefeuchtung
bzw. Umverteilung des Wassergehaltes
|
Diese Risiken treten
hauptsächlich bei feuchten Holzhackschnitzeln
oder Rinde auf Grund biologischer Vorgänge
auf. Deswegen sollte nur trockenes Holz zu Hackschnitzel
verbarbeitet werden. |
|
Luftkollektortrocknung |
Quelle:
TFZ - Technologie- und Förderzentrum Bayern |
|
Waldhackschnitzel
sollten möglichst schnell auf < 30 % Wassergehalt
heruntergetrocknet werden. Kleinere Hackschnitzel-Heizungsanlagen
arbeiten nur mit trockenem Hackgut (10 - 30 % Wassergehalt).
Die natürliche Trocknung erfolgt
durch Konvektion. Dabei steigt warme Luft aus dem Hackschnitzelhaufen
auf Grund der Temperaturdifferenz zwischen der Schüttungs-
und der Umgebungstemperatur auf und transportiert die
Feuchtigkeit ab. Deswegen muss das Schüttgut
gut belüftet werden. Damit die Trocknung
beschleunigt wird, kann die Abwärme von Kraftwerken
(Biogasanlagen, BHKW) genutzt oder Solarsysteme
(Solar-Luftkollektoren), die auf dem Gewächshausprinzip
basieren, verwendet werden. |
|
|
Satz-
oder Kastentrockner |
Quelle:
TFZ - Technologie- und Förderzentrum Bayern |
|
|
Die Lagerung kann
in Außenlager und in Lagerräumen
(Kellerraum, Anbau, unterirdischer Raum), Lagerschuppen,
Heizzentralen und in Silos durchgeführt
werden. Einige Pelletlagerbehälter
und Pelletentnahmesysteme
eignen sich auch für die Lagerung und Entnahme von Holzhackschnitzel. |
| Empfehlungen für
die Hackschnitzellagerung |
- Trockenes Holz hacken:
Eine Vortrocknung des zu hackenden Holzes auf einem geeigneten Lagerplatz
kann den Wassergehalt innerhalb einiger Monate auf 30% senken. Ein
idealer Lagerplatz zum Vortrocknen sollte gut durchlüftet werden
und besonnt sein, waldnah liegen, trockenen Untergrund aufweisen
sowie ganzjährig anfahrbar sein
- Hohe Hackschnitzelqualität:
Grobes, scharfkantiges Hackgut mit Kantenlängen von etwa 5
cm, das wenig Grünanteile und Feinmaterial enthält, bietet
geschüttet genügend Zwischenräume, in denen die Luft
gut zirkulieren kann und die Feuchtigkeit abgeführt wird. Es
trocknet deutlich schneller als zerbreites, feines Material mit
hohen Nadelanteilen
- Außenlager sollten
auf trockenen Untergrund angelegt werden und sonnig
und gut durchlüftet liegen. Die Haufen sind in Form von Spitzkegeln
auszubilden, um die Durchfeuchtung bei Regen möglichst gering
zu halten. Bewährt hat sich die Abdeckung mit Vlies, das den
Regen abfließen lässt, aber eine Verdunstung des Wassers
aus dem Lagerhaufen zulässt
- Überdachte Innenlager
sollten hoch und gut belüftet sein, um eine Kondensation über
dem Hackschnitzelhaufen zu verhindern. Gut geeignet sind beispielsweise
kostengünstige Lagerhallen in Rundholzbauweise. Luftdurchlässige
Seitenwände und unter Umständen ein Boden aus Rundholzbohlen
gewährleisten den Abzug der warmen, feuchten Luft und stellen
die Zufuhr kalter Außenluft sicher. Bewährt hat sich
auch eine Lagerung in Draht- oder Holzgitterkästen. Die Hackschnitzel
sollten zur Vergrößerung der Trocknungsfläche auch
hier dammförmig aufgeschüttet werden. Bei einer Lagerung
im Bunker ist ein Abluftsystem vorzusehen. Die Abluft kann direkt
in den Brennraum geleitet werden, wodurch schädliche Schimmelsporen
verbrannt werden
- Kurze Lagerdauer:
Die Hackschnitzel sollten nur kurze Zeit gelagert werden (Anhaltswert
drei Monate). Durch eine entsprechende räumliche Ordnung ist
die Verwendung in der Reihenfolge der Einlagerung zu gewährleisten
(Prinzip: first in - first out)
- Kontakt mit Schimmelsporen
vermeiden: Hackschnitzellager sind möglichst entfernt
von Arbeits- und Wohnplätzen unter Beachtung der Hauptwindrichtung
anzulegen. Kleider, Nahrungs- oder Genussmittel sollten nicht in
Räumen aufbewahrt werden, in denen Hackschnitzel lagern.
Quelle: Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft |
Hackschnitzel richtig lagern - LWF |
|
Beschickungs-
und Entnahmesysteme |
Die Lagerbeschickung und -entnahme
von Hackschnitzeln erfolgt in Großanlagen durch entsprechende Ladefahrzeuge
(Schlepper, Gabelstapler, Radlader, Teleskoplader). Insbesondere der Gabelstapler
ist in fast jedem Betrieb zu finden und aus der innerbetrieblichen Logistik nicht mehr wegzudenken.
Als Basis für die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten des Staplers dienen die Gabelzinken.
Neben herkömmlichen Gabelzinken besteht eine große Vielfalt an Erweiterungen um das Thema Stapler-Gabeln,
um die Nutzung flexibler zu gestalten. Eine
Gabelverlängerung hilft beim Problem, wenn Lasten angehoben und transportiert
werden sollen, die länger als die vorhandenen Stapler-Gabeln sind. So kann ein aufwendiges Wechseln der Gabeln
obsolet gemacht werden. Eine weitere Hilfe sind Anti-Rutsch-Auflagen, mit denen die Lagergüter
sicher und schonend transportiert werden können. Sicherheit ist auch bei der Beschickung von Hackschnitzeln ein
wichtiger Faktor.
Bei einer Hackschnitzelbereitung am Lagerraum erfolgt ein direkter
Eintrag über den Wurfförderer des Hackers. Für den automatischen
Betrieb der Feuerungsanlage werden spezielle Austragssysteme für die
Brennstoffentnahme aus dem Silo oder Lagerraum eingesetzt. |
|
Silo-
und Raumaustragssysteme für quadratische und runde Lagerquerschnitte
bei kleineren und mittleren Hackschnitzellagern |
Quelle:
TFZ - Technologie- und Förderzentrum Bayern |
|
ich suche
ein Bild |
Federkernaustragung |
Quelle:
|
|
Blattfederrührwerke
sind bei kleineren Feuerungsanlagen mit Hochbehältern
sind vorgefertigte Silo-Unterbau-Austragseinrichtungen weit
verbreitet. Um Förderunterbrechungen durch Brückenbildung
zu vermeiden, wird dabei ein möglichst großer
Entnahmequerschnitt angestrebt. Das wird häufig durch
Blattfederrührwerke erreicht, bei denen sich ein Blattfederpaar
im Falle einer Hohlraumbildung am Siloboden entspannt und
während der Rührarbeit radial ausbreitet. Dadurch
werden auch weiter außen liegende Brennstoffschichten
gelockert und ausgetragen, bis die hohl liegende Schüttung
von oben nachrutscht. Unterhalb der Rotationsebene der Blattfedern
arbeitet eine Entnahmeschnecke, die sich in einem nach oben
offenen Bodenschacht befindet. Je nach Wartungsansprüchen
verläuft die Austragsebene entweder waagerecht oder
als schiefe Ebene. |
| Quelle: TFZ - Technologie-
und Förderzentrum Bayern |
|
|
Drehschnecken
bewerkstelligen neben der Lockerungsarbeit auch den radialen
Transport beispielsweise der feuchten oder trockenen Hackschnitzel
zum zentralen Entnahmepunkt.
Konusschnecken arbeiten dagegen in geneigter
Stellung und erfüllen eher eine Rührwerksfunktion
für den selbsttätig nachrutschenden meist trockenen
Hackschnitzelbrennstoff. Der Wirkdurchmesser dieser auch
als Pendelschnecke bezeichneten Rühreinrichtung kann
bei 2 bis 5 m liegen.
Bei rechteckigen Siloquerschnitten besteht bei diesen Austragssystemen
jedoch der Nachteil, dass der Lagerraum nie vollständig
automatisch entleert werden kann. |
Dreh-
oder Austragsschnecken sind am äußeren
Grat der Schneckenwendel meist mit Mitnehmern bestückt,
die das Lockern und Ablösen des Brennstoffs aus dem
Materialverbund im Lager unterstützen. Für besonders
hohe Förderleistungen werden auch Schneckenpaare verwendet,
die den Brennstoff von zwei Seiten her zum Drehpunkt hin
fördern. |
| Quelle: TFZ - Technologie-
und Förderzentrum Bayern |
|
ich suche
ein Bild |
Konusschnecke |
Quelle:
|
|
|
ich suche
ein Bild |
Schubboden |
Quelle:
|
|
Schubböden
decken den gesamten (rechteckigen) Lagerbodenbereich ab.
Sie besitzen eine oder mehrere Schubstangen mit Mitnehmern,
die horizontal vor- und zurückbewegt werden. Die Schubstangen
werden mit Hydraulikzylindern angetrieben, die außerhalb
des Lagerraums arbeiten. Durch die keilförmige Form
der Mitnehmer wird der Brennstoff in Richtung einer stirnseitig
oder mittig verlaufenden Querrinne geschoben, in der sich
z. B. ein Schnecken- oder Kettenförderer befindet,
der den Brennstoff dann zur Feuerung transportiert. Schubböden
zeichnen sich u. a. durch hohe Betriebssicherheit und Unabhängigkeit
von Form und Größe des Brennstoffs aus,
sie werden deshalb auch häufig in größeren
Feuerungsanlagen verwendet. In Kleinanlagen kommt das Schubbodenprinzip
lediglich als vorgefertigter Silo-Unterbau für kleinere
Hochlager zum Einsatz, es kann aber auch in Wechselcontainern
verwendet werden. |
| Quelle: TFZ - Technologie-
und Förderzentrum Bayern |
|
|
Bei der Förderung
von Biomasse wird zwischen pneumatischen
Systemen (Förderung im Luftstrom)
und mechanischen Systemen unterschieden.
In der Praxis der Kleinfeuerungen ist die
mechanische Förderung mit Schnecken
am meisten verbreitet, sowohl zur Entnahme als auch zur
Anlagenbeschickung. Der Förderdurchsatz ist dabei unter
anderem von der Neigung der Förderstrecke abhängig;
sie bestimmt die Füllhöhe zwischen den Schneckenwindungen.
Feinere Materialien (Pellets, Körner) neigen bei Gefällestrecken
zudem zum Zurückrieseln (Schlupf), was ebenfalls die
Förderleistung mindern kann.
Für größere Anlagenleistungen
oder bei problematischeren Materialien (z. B. gröberes
Hackgut) kommen auch andere Systeme wie
z. B. Kratzkettenförderer, Schwingförderer (Vibrorinnen)
oder Förderbänder zum Einsatz. |
Quelle:
TFZ - Technologie- und Förderzentrum Bayern
|
|
|
Bauart
und Verwendung von Schneckenfördersystemen |
Quelle:
TFZ - Technologie- und Förderzentrum Bayern |
|
|
|
| |
Bei dem
Einbau einer Pelletheizung und der Einrichtung einer Pelletlagerung
sind Vorschriften bezüglich „fester Brennstoffe“ zu
beachten. Hier gelten die Heizraumrichtlinien
(ab 50 kW) bzw. ab 15 t Lagermenge ist ein separater
Lagerraum vorgeschrieben. Dabei sind die gesetzlichen Vorschriften
der Feuerungsverordnungen
(FeuVO) der Bundesländer zu beachten und die allgemeinen Brandschutzbestimmungen
einzuhalten. Bei der Lagerung kleinerer Mengen gibt es spezielle Lösungen.
|
| Die Lagerung von Pellets gibt es folgende
Möglichkeiten |
- Lagerraum - umbauter Raum
(z. B. alter Heizöllagerraum)
- Sacksilo
- Lagertank (Silos, Pelletboxen)
- Erdtank
|
|
|
|
| Festmeter – Holz |
Massives Holz mit den
Kantenlängen 1m x 1m x 1m (1 m3) bezeichnet man als Festmeter (FM).
Da Brennholz nie ohne Luftzwischenräume geliefert bzw. gelagert
werden kann, wird diese Maßbezeichnung in der Praxis nicht verwendet. |
Bei der Maßbezeichnug
"Festmeter" wird zwischen Vorratsfestmeter
(VFM) - Holz mit Rinde - und Erntefestmeter (EFM) –
Rinden- und Holzernteverluste abgezogen – unterschieden. In der
Praxis wird mit Raummeter gerechnet. |
Raummeter –
Holz |
Scheitholz (Kaminholz)
wird mit der Maßbezeichnung "Raummeter" gehandelt. Die
alte Bezeichnung ist Ster. Ein Raummeter (RM) hat die Lagermaße
1 m x 1 m x 1 m (1 m3), wobei im Gegensatz zum Festmeter
die Luftzwischenräume der gestapelten Holzscheite mitgerechnet
werden. |
So entspricht
ca. 1,6 Raummeter 1 Festmeter |
In
einigen Gegenden wird auch mit dem Schüttraummeter
(SRM) gehandelt. Hier werden ofenfertigen Holzscheite (25 cm oder 33
cm lang) oder Hackschnitzel in einen Behälter mit den Maßen
1 m x 1 m x 1 m geschüttet. Dadurch entstehen größere
Zwischenräume. Also ist dieses Maß kleiner gegenüber
einem Raummeter. |
So sind ca.
0,7 Raummeter ein Schüttraummeter (33cm Holzscheite) und etwa 0,4
Festmeter |
Es gelten folgende
Richtwerte zur Umrechnung |
Umrechnungszahlen
für Holzraummaße |
1,0
Festmeter (FM) |
1,6
Raummeter/Ster (FM) |
2,0
bis 2,4 Schüttraummeter (SRM) |
0,7
Festmeter (FM) |
1,0
Raummeter/Ster (FM) |
1,4
bis 1,6 Schüttraummeter (SRM) |
0,5
Festmeter (FM) |
0,7 Raummeter/Ster (FM) |
1,0
bis 1,2 Schüttraummeter (RM) |
|
|
Quelle: TFZ
- Technologie- und Förderzentrum Bayern |
Das alte Holzraummaß
"Klafter" wird nicht mehr verwendet. Das
Maß entspricht einen Stapel Scheitholz von ca.
1,8 m Länge und Höhe und einer Tiefe von ca. 0.9 m. Was ca.
3 - 4 Raummeter (Ster) bzw. ca. 2–3 Festmetern entspricht. Dieses
Holzmaß ist nicht einheitlich geregelt und je nach Gegend unterschiedlich
und liegt zwischen 1,8 bis 3,9 m3.
Das Klafter war auch ein Längenmaß,
dabei wurde die Länge zwischen den Fingerspitzen der ausgestreckten
Arme eines Mannes (regionsabhängiges 1,70 - 1,90 m) gemessen. |
|
|
Feuchtigkeitsmesser |
Quelle:
Wetekom |
|
Um
die Feuchtigkeit zu überprüfen,
wird in der Praxis häufig die Leitfähigkeitsmessung
(Elektrische Widerstandmessung) eingesetzt. |
| Dabei werden
zwei Elektroden in das Holz eingelassen. Der vom Gerät
erzeugte Messstrom fließt durch die Elektrode in das
Holz und über die zweite Elektrode wieder zurück
zum Gerät. |
Je leitfähiger
das Holz (Feuchtigkeit, Salze usw.) umso mehr Strom fließt
zurück. Es wird ein Wert in Digis ausgegeben. |
Ein
Tipp aus der Praxis: Bei dieser Art der Feuchtemessung
sollte ein Holzscheit vor der Messung noch einmal
gespalten werden. |
|
|
|
Feuchtigkeitsmessgerät
für Holz und Baustoffe |
Quelle:
HEDÜ GmbH |
|
Feuchtigkeitsmessgerät
mit Sucher- und Nadelmodus
für die Messung von Feuchte in Holz
und Baustoffen. |
| Baustoffe
und Holz mit glatter Oberfläche werden im Suchermodus
(kapazitive Messung). Holz mit rauer Oberfläche
im Nadelmodus (Leitfähigkeitsmessung)
evtl. auch mit Einschlag-Elektroden für
Tiefenmessungen in Hölzern. |
Das Messgerät
ist auch für geeignet, um Feuchtigkeitsdifferenzen
im Estrich zu erkennen. Dabei erfolgt die Messung
zerstörungsfrei und schnell. Bei zu hohen Feuchtewerten
erübrigt sich eine zerstörende Messung im Trockenschrankverfahren
oder mit der CM-Methode. Innerhalb eines Raumes können
große Feuchtedifferenzen vorhanden sein, deshalb ist
eine zerstörungsfreie Messung vorteilhaft um die kritischen
Stellen für eine genauere Untersuchung zu ermitteln.
Die Zahl der notwendigen, aber zeitaufwendigen, Messungen
wird reduziert. |
|
|
|
CO2-neutral
Die Begriffe "CO2-neutral"
oder "klimaneutral" sollen aussagen, dass
die eingesetzten Brennstoffe (z. B. Holz, Pellets)
oder die Aktivitäten der Menschen (z. B. Biokraftstoffe,
E-Antrieb über Photovoltaik) keinen Einfluss auf den CO2-Gehalt
(Kohlendioxid-Konzentration) der Atmosphäre haben
sollen. Dadurch wird der Eindruck erweckt, dass deren
Verwendung nicht klimaschädlich ist.
Alle "CO2-neutralen kohlenstoffhaltigen Brennstoffe"
(z. B. Holz, Pellets, Biokraftstoffe
[Biogas, Biodiesel und Bioethanol] aus Biomasse [Pflanzenmaterial])
setzen bei ihrer Verbrennung CO2
frei und emitieren diesen in die Atmosphäre.
Die CO2-Emissionen können so kompensiert
sein, dass das CO2 der Atmosphäre wieder zu Kohlenstoff
wird (z. B. Holz- und Pflanzenwachstum).
Leider wächst das Holz eines Waldes nicht
so schnell nach (CO2-Aufnahme > Bildung und Ablagerung
von Kohlenstoff), wie es bei der Verbrennung genutzt wird, Das gleiche
gilt auch für die Pflanzen (Biomasse, z. B. Mais,
Raps), aus denen die Biokraftstoffe (Biogas, Biodiesel und Bioethanol)
werden aus Pflanzenmaterial gewonnen werden. Auf der anderen Seite würde
aber bei der nutzlosen Verrottung von Holz
und Pflanzen auch CO2 und das erheblich
schädlichere Methan
freigesetzt werden, das 20
bis 30mal schädlicher gegenüber
dem CO2 ist. Hierüber
wird immer noch gestritten, ob bei der Verbrennung nur so viel CO2
(Klimagas)
freigesetzt wird, wie es sonst ohnehin mit der zusätzlich Entstehung
von Methan (Klimagas)
entstanden wäre.
Auch wenn sich die Brenn- und Kraftstoffe
als "CO2-neutral" oder "klimaneutral"
erweisen, sollte auch die "Graue
Energie" mit eingerechnet werden. Hierbei handelt
es sich um die Energiemenge, die für die Herstellung,
den Transport, der Lagerung, des Verkaufs
und der Entsorgung der Produkte benötigt wird.
Dabei wird sich herausstellen, dass es hier
und auch bei Solaranlagen keine Klimaneutralität
geben wird. |
|
CO2-Lüge
Das Schlagwort "CO2-Lüge"
soll, genauso wie das Schlagwort "Dämm-Lüge",
zum Nachdenken anregen.
Sind die Kohlenstoffdioxid-Emissionen,
die durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe (Heizung,
Kraftwerke, Autos, Flugzeuge) oder durch das Emitieren
durch Menschen, Tiere und sogar Bäume
und Pflanzen in die Atmosphäre eingetragen werden,
wirklich für die globale Temperaturerwärmung
der Atmosphäre verantwortlich?
Auf jeden Fall wird durch
die Medien und Regierungen ständig
behauptet, dass die CO2-Emissionen durch
Menschen die Hauptschuld am Klimawandel
haben. Die Folge sind immer schärfere Gesetze
(z. B. Energieeinsparungsgesetz [EnEG],
BImSchG
[VO nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz]) und Verordnungen
(z. B. Energieeinsparverordnung [EnEV])
zur CO2-Reduzierung. Dass es Veränderungen
in einigen Klimazonen gibt, ist eine Tatsache, aber
diese Veränderungen hängen auch von sehr
vielen anderen
Klimafaktoren ab, die näher betrachtet bzw. berücksichtigt
werden sollten.
- Ständig steigende
natürliche Produktion von Methan.
Dieses Gas ist 20 bis 30mal schädlicher als CO2.
- Warum wird CO2 (z. B. Holz, Pflanzen)
nicht, z. B. in Bergwerke, eingelagert? Dann wird das
Material nicht verbrannt und kann das aufgenommene CO2
nicht abgeben.
- Unzureichende und viel zu ungenaue Temperaturdaten
der Troposphäre, die maßgeblich für
die Erfassung von Klimadaten sind.
- Immer noch viel zu starke Abholzung der Regenwälder.
Dadurch wird die Verwüstung von ganzen Landstrichen
provoziert. Ist die Temperaturerhöhung des Klimas an der zunehmenden
Ausbreitung von Trockenzonen verantwortlich?
- Abnehmende Temperaturen in der Tiefsee,
welche seit mehreren Jahren schon beobachtet werden.
- Die gestiegene Sonnenaktivität kann einen wesentlichen
Einfluss auf die Erdtemperatur ausüben. Eine gestiegene Sonnenaktivität
sendet mehr Wärmestrahlung (Infrarotfrequenzen) aus.
- Extreme Zunahme von Mikrowellenemissionen
(global) durch stetig ansteigende Sendeleistungen bzw.
ansteigenden Sendeanlagen der Kommunikationssyteme.
Mikrowellen regen Moleküle (Wasser, CO2) an und können
innerhalb weniger Jahrzehnte auch Auswirkungen auf die Erwärmung
der Atmosphäre haben.
- CO2 ist aufgrund seines molekularen Aufbaus
auch in der Lage Infrarotfrequenzen zu reflektieren
und damit Wärme in der Atmosphäre zu erzeugen.
- Es wird immer wieder behauptet, dass der CO2-Anstieg
in der Atmosphäre beängstigend hoch sein soll. Der CO2-Gehalt
ist von 280 ppm auf 340 ppm gestiegen. Diese Werte machen auf den Gesamtgasgehalt
der Erdatmosphäre gesehen, überhaupt keine nennenswerte Änderung
aus. Der Anstieg von CO2
ist und bleibt verschwindend gering, denn der Gehalt
an CO2 in der Erdatmosphäre
liegt weiterhin bei 0,038 %. Man sollte sich über
die wirklichen Treibhausgase
(z. B. Methan, Stickoxide, Distickstoffoxid, Ozon, atmosphärischer
Wasserdampf, Schwefelhexafluorid) mehr Gedanken machen.
- Ob die abschmelzende Gletscher ein Zeichen für
den Klimawandel sind, wird auch strittig diskutiert, weil es auch Gegenden
gibt, die eine Zunahme an Eis und
Schnee haben. So war z. B. der Nordpol periodisch in
der Erdgeschichte wiederholt eisfrei.
Meinungen zu diesem Thema
nehme ich gerne entgegen. |
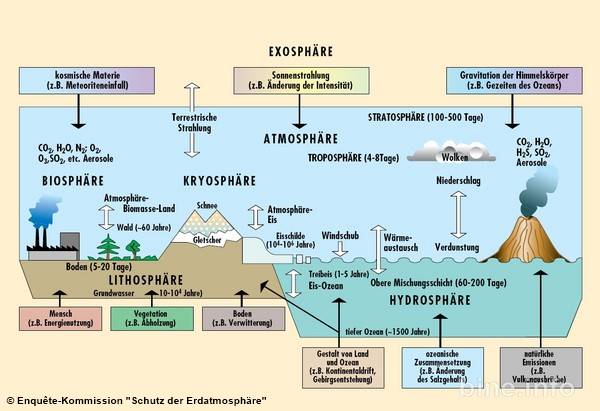 Das
Klimasystem
Quelle: © Enquête-Kommission
"Schutz der Erdatmosphäre"
Das
Klimasystem
Quelle: © Enquête-Kommission
"Schutz der Erdatmosphäre" |